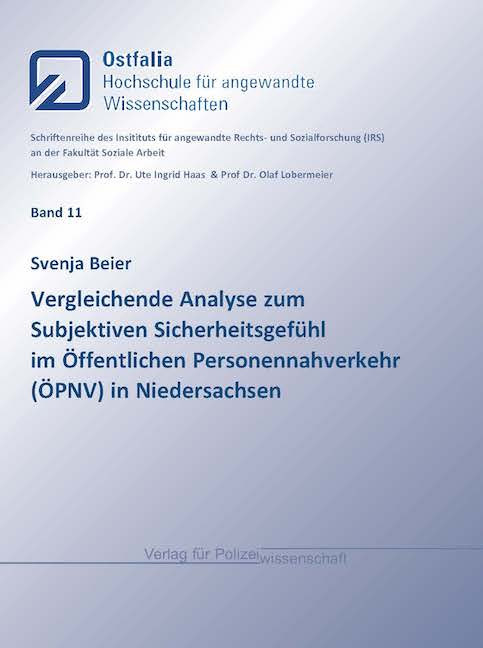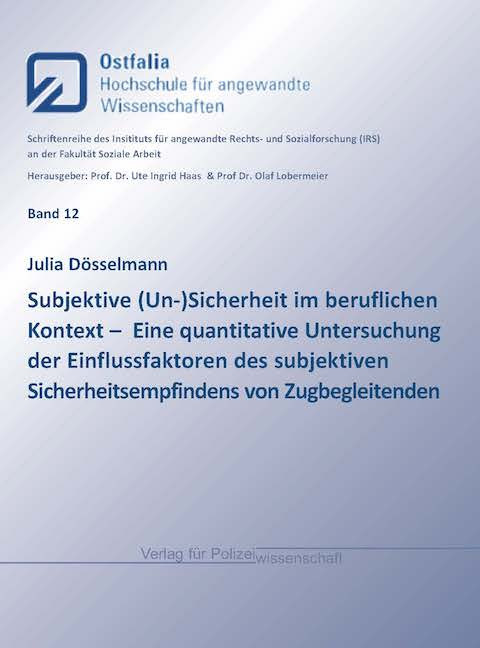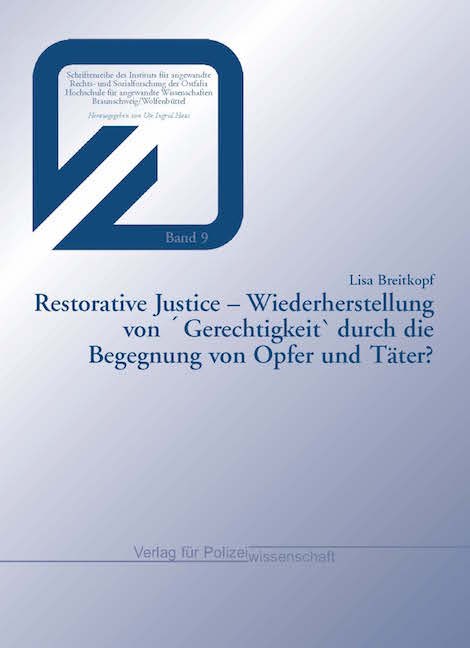Svenja Beier
Vergleichende Analyse zum Subjektiven Sicherheitsgefühl im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Niedersachsen

Das Subjektive Sicherheitsgefühl im öffentlichen Personennahverkehr unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren, welche sich hinsichtlich der untersuchten Zielgruppe noch einmal unterscheiden und somit ein heterogenes Bild ergeben. Mit Hilfe einer vergleichenden Analyse von drei vorliegenden Erhebungen wurden diese Faktoren quantitativ ermittelt.
Es zeigte sich, dass unter allen Teilnehmenden ein allgemein hohes Sicherheitsempfinden vorherrscht, welches allerdings durch Personal, durch ausreichende Beleuchtung und durch die Anwesenheit bestimmter Personengruppen sowie durch das Alter und das Geschlecht beeinflusst werden kann. Insbesondere durch Personalerweiterungen, verbesserte Sicherheitstrainings und verständliche Informationen kann das Sicherheitsgefühl der Befragten gesteigert werden. Somit leistet dieser Band einen Beitrag zur Verbesserung des Subjektiven Sicherheitsgefühls im öffentlichen Personennahverkehr.
Inhalt
Inhalt:
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Rahmen und methodische Konzeption
2.1 Subjektive Sicherheit und Kriminalitätsfurcht
2.1.1 Begriffsbestimmung
2.1.2 Erklärungsansätze
2.1.3 Stand der Forschung
2.2 Theorie der sozialen Kontrolle und sozialen Desorganisation
2.2.1 Theorie der sozialen Kontrolle
2.2.2 Soziale Desorganisation
2.3 Forschungsinteresse und Fragestellung
2.3.1 Forschungsinteresse
2.3.2 Fragestellung
2.4 Forschungsdesign
3 Durchführung der empirischen Untersuchung
3.1 Methodisches Vorgehen
3.2 Datenbasis
3.2.1 Forschungsprojekt von Beier und Dösselmann
3.2.2 Forschungsprojekt von Blank und Hügel
3.2.3 Forschungsprojekt von Schmid, Trübutschek und Windler
3.3 Stichprobenbeschreibung
4 Ergebnisdarstellung
4.1 Untersuchungsdurchführung
4.2 Ergebnisse der Untersuchung
4.2.1 Sicherheitsgefühl
4.2.2 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
4.2.3 Übergriffe
4.2.4 Verbesserungsvorschläge
4.3 Ergebnisdiskussion
5 Kritische Reflexion und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Julia Dösselmann
Subjektive (Un-)Sicherheit im beruflichen Kontext Eine quantitative Untersuchung der Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsempfindens von Zugbegleitenden

Beleidigungen, Bedrohungen, Schläge und Tritte. Leider gehören diese Erlebnisse inzwischen zum beruflichen Alltag vieler Zugbegleitender. Aufbauend auf einer qualitativen Vorstudie wird daher in der vorliegenden Untersuchung das subjektive Sicherheitsempfinden der KundenbetreuerInnen sowie dessen Einflussfaktoren mithilfe einer standardisierten Online-Befragung analysiert.
Damit gibt das vorliegende Buch einen Einblick in das bislang kaum erforschte subjektive Sicherheitsempfinden im beruflichen Kontext und klärt über dessen Ursachen auf. So können das Alter und Geschlecht der Befragten, die Häufigkeit der Teilnahme an Deeskalationstrainings, die erlebte berufliche Viktimisierung und die Einschätzung der eigenen Verletzbarkeit als wesentliche Einflussfaktoren des Sicherheitsempfindens am Arbeitsplatz bestimmt werden. Durch das Erarbeiten entsprechender Maßnahmen leistet der Band zudem einen Beitrag zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Zugbegleitenden an ihrem Arbeitsplatz.
Inhalt
Inhalt:
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Rahmen
2.1 Subjektive Sicherheit
2.1.1 Das Konzept der subjektiven Sicherheit
2.1.2 Subjektive Sicherheit im beruflichen Kontext
2.2 Aggression und Gewalt in modernen Gesellschaften
2.3 Routine-Aktivitäts-Theorie
2.4 Lebensweltansatz nach Schütz und Luckmann
3 Fragestellung und Hypothesen
3.1 Die Fragestellung und ihre Herleitung
3.2 Hypothesen
4 Untersuchungsdesign, Stichprobe und Operationalisierung
4.1 Untersuchungsdesign
4.2 Erhebungsmethode
4.3 Stichprobe
4.4 Operationalisierung
4.4.1 Subjektives Sicherheitsempfinden und Verletzbarkeit
4.4.2 Erfahrung mit Übergriffen und Lösungsansätze
4.4.3 Arbeitsumgebung und Qualifikationen
4.4.4 Demografische Daten
4.5 Erhebungsdurchführung, Datenbereinigung und Datenanalyse
5 Ergebnisse der Untersuchung
5.1 Deskriptive Ergebnisse
5.1.1 Qualifikationen, Arbeitsalltag und Berufserfahrung der Zugbegleitenden
5.1.2 Erfahrung mit Übergriffen und Sicherheitsgefühl am Arbeitsplatz
5.1.3 Lösungen für das Sicherheitsproblem und Anmerkungen der Zugbegleitenden
5.1.4 Einflüsse auf das subjektive Sicherheitsempfinden (bivariate Analysen)
5.2 Hypothesenprüfende Ergebnisse
5.2.1 Hypothese I
5.2.2 Hypothese II
5.2.3 Hypothese III
6 Ergebnisdiskussion
6.1 Interpretation der Ergebnisse
6.2 Einordnung der Ergebnisse in den Stand der Forschung
6.3 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung
6.4 Ableitung von Handlungsempfehlungen
7 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Lisa Breitkopf
Restorative Justice Wiederherstellung von ´Gerechtigkeit` durch die Begegnung von Opfer und Täter?

An dieser Kontroverse setzt der Gedanke der „heilenden Gerechtigkeit“, der Restorative Justice, an. Restorative Justice verfolgt das Ziel, das Gleichgewicht zwischen Opfer und Täter nach dem einschneidenden Erlebnis einer Straftat wiederherzustellen. Eine Begegnung beider Seiten soll das Opfer bei der Bewältigung des Tatereignisses mit seinen Folgen stärken und gleichzeitig den Täter in seinem Bemühen um Verantwortungsübernahme unterstützen. Dabei kann der Täter-Opfer-Ausgleich als einen ersten Schritt in Deutschland betrachtet werden, ein restoratives Konzept rechtlich zu verankern.
Die unzureichende Berücksichtigung von Restorative Justice in Deutschland greift die vorliegende Arbeit auf und möchte anhand einer quantitativen Online-Befragung von (potenziellen) Opfern deren Bereitschaft für eine Begegnung und Wiederherstellung von Gerechtigkeit untersuchen.
Die Forschungsarbeit stellt sich der Herausforderung, eine Annäherung an den Themenkomplex der Restorative Justice zu wagen. Sie möchte einen Beitrag leisten, restorative Gedanken bei den Mitgliedern der Gesellschaft anzuregen, um sich wieder mehr auf das eigene Konfliktlösungsgeschick und die demokratische Verantwortung zu besinnen.
Inhalt
Inhalt:
Einleitung
Teil I: Von der Täterorientierung zur Restorative Justice
1 Das Opfer während und nach der Straftat – eine vernachlässigte Gruppe?
1.1 Die Situation der Opfer in Deutschland
1.2 Folgen der Straftat für das Opfer
1.3 Bedürfnisse und Opfererwartungen nach der Straftat
2 Die Resozialisierung des Täters – gescheitert?
2.1 Folgen der Straftat für den Verursacher: Strafvollzug
2.2 Wirkungen von Strafe und Strafvollzug
2.3 Einsicht und Verantwortungsübernahme zur Verhinderung eines Rückfalls
2.4 Notwendigkeit einer alternativen Methode?
3 Restorative Justice – die Lösung?
3.1 Wiederherstellung von Gerechtigkeit durch Wiedergutmachung
3.2 Bedeutung der Begegnung – direkt und/oder indirekt
4 Aktuelle Handhabung in Deutschland
Teil II: Empirische Forschung
5 Forschungsdesign
5.1 Erhebungsmethode Fragebogen
5.1.1 Fragestellung und methodisches Vorgehen
5.1.2 Hypothesen
5.1.3 Online-Befragung
5.1.4 Fragebogenkonstruktion
5.1.5 Pretest
5.2 Durchführung
5.2.1 Beschreibung der Stichprobe und Zugang zum Feld
5.2.2 Durchführung der Erhebung
5.3 Auswertungsmethode
5.3.1 Aufbereitung des Datenmaterials
5.3.2 Deskriptive Datenanalyse
5.3.3 Interferenzstatistik
6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Befragung von (potenziellen) Opfern
6.1 Vorstellung der Online-Befragung
6.2 Möglichkeit einer Begegnung in Abhängigkeit vom Geschlecht
6.3 Möglichkeit der Begegnung in Abhängigkeit zur Opfererfahrung
6.4 Einstellung zu Strafe und Gerechtigkeit
6.5 Einschränkungen der Begegnung
Teil III: Abschließende Betrachtung
7 Fazit
8 Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang