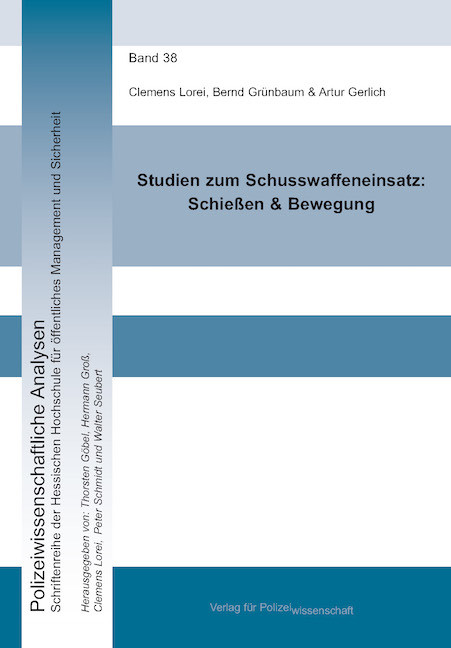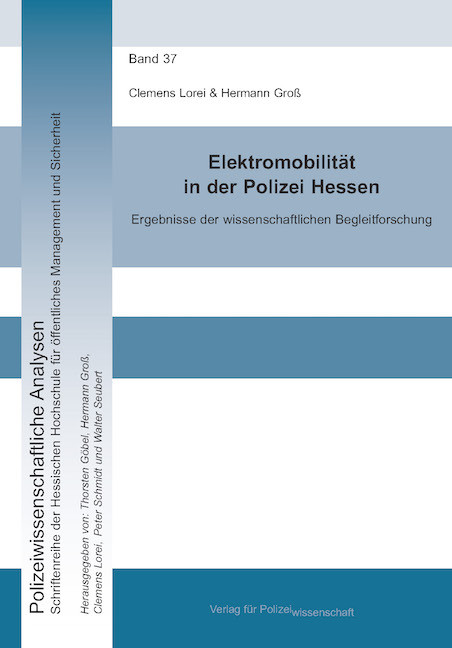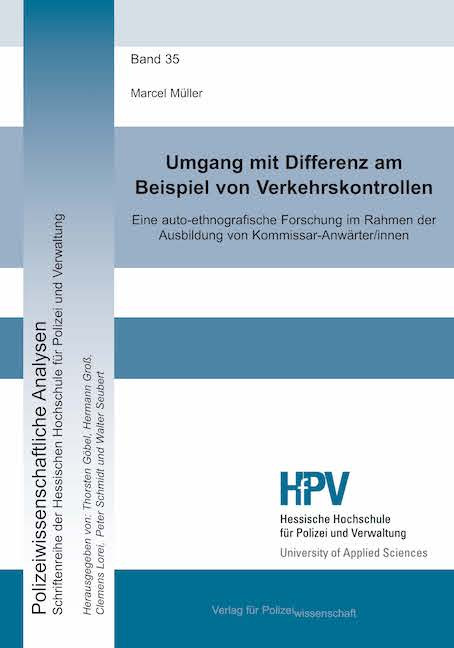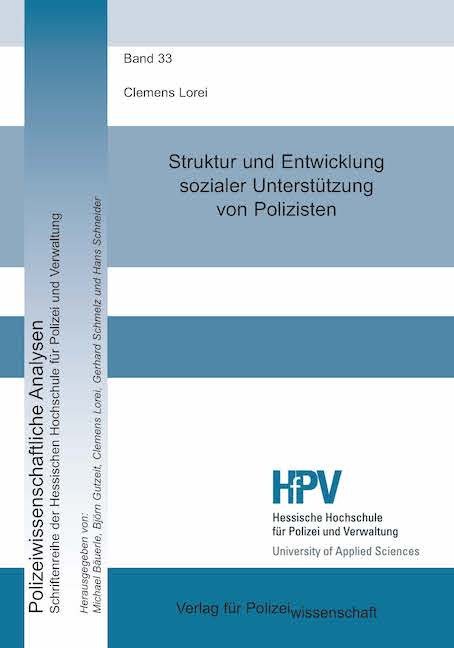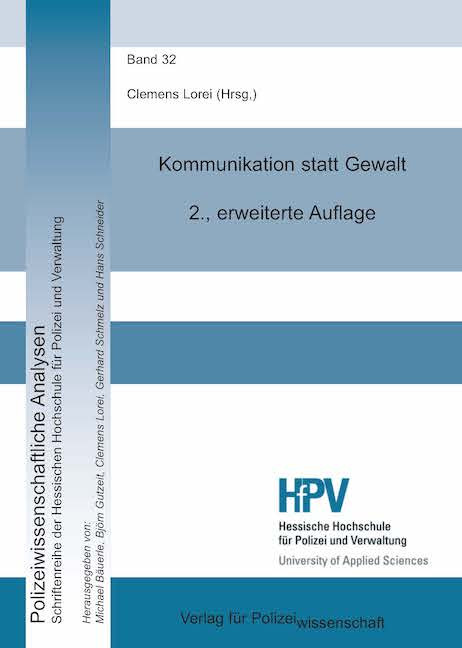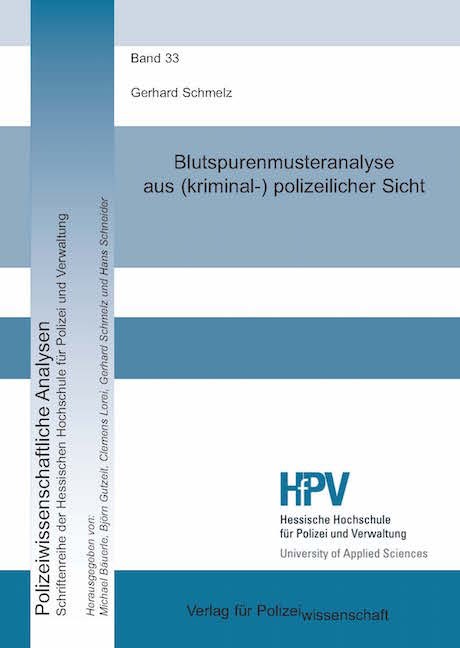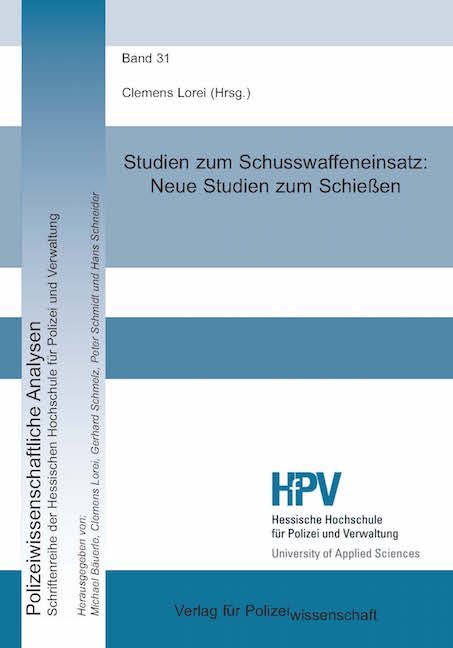Der polizeiliche Schusswaffengebrauch stellt wahrscheinlich die gravierendste Eingriffsmaßnahme dar, die ein Polizeibeamter treffen kann. Aus diesem Grund muss er hierauf unbedingt umfassend und nach besten Möglichkeiten vorbereitet werden, um entsprechende Gefahren für sich oder andere abwehren zu können und Unbeteiligte keiner Gefährdung auszusetzen. Die in diesem Band dokumentierte Studienserie will deshalb dazu beitragen, die wissenschaftliche Diskussion um den polizeilichen Schusswaffengebrauch anzuregen und helfen, die Schießaus- und -fortbildung bzw. das gesamte Einsatztraining zu optimieren.
Bei polizeilichen Schusswaffengebräuchen werden häufig Trefferquoten berichtet, die deutlich niedriger sind als die Schießleistung im Training. Als einer der Faktoren, welche die Trefferquote im Einsatz reduzieren können, wird die Dynamik der Situation angeführt. Dies meint, dass sich in polizeilichen Feuergefechten der Schütze mitunter bewegt und in oder aus der Bewegung auf ein sich vielleicht ebenso bewegendes Ziel schießt. Dies kann per se mit einer geringeren Trefferwahrscheinlichkeit bzw. einer höheren Schwierigkeit zu treffen verbunden sein. Des Weiteren kann es aber auch sein, dass diese Art zu schießen weniger geübt ist, da Aus- und Fortbildung häufig oder überwiegend statisches Schießen auf statisches Ziel beinhaltet.
Letztendlich ist der Einfluss von Bewegung – sowohl Bewegung des Schützen wie auch Bewegung des Ziels – auf das Treffen beim polizeilichen Schusswaffengebrauch kaum untersucht. Deshalb widmet sich die hier vorgelegte Studie mit einer Untersuchungsserie dem Einfluss von Bewegung auf das polizeiliche Schießen.
Inhalt
Inhalt:
1 EINLEITUNG
2 THEORETISCHER HINTERGRUND
2.1 REALITÄT DES POLIZEILICHEN SCHUSSWAFFENGEBRAUCHS
2.2 TREFFERQUOTEN BEIM POLIZEILICHEN SCHIEßEN
2.3 BEWEGUNG UND SCHIEßEN
2.4 ZIELE & HYPOTHESEN
3 METHODE
3.1 VERSUCHSPERSONEN
3.2 VERSUCHSAUSBAU
3.3 AUFBAU DER STUDIE
3.4 TREFFERAUFNAHME
3.5 DATENBEREINIGUNG
4 ERGEBNISSE
4.1 SERIE BEWEGTE ZIELE
4.1.1 BEWEGUNGSRICHTUNG
4.1.1.1 Horizontal
4.1.1.2 Diagonal
4.1.1.3 Zufällig
4.1.2 BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT
4.1.2.1 Langsam
4.1.2.2 Schnell
4.2 SERIE SICH BEWEGENDE SCHÜTZ*INNEN
4.2.1 BEWEGUNGSRICHTUNG
4.2.1.1 Vorwärts
4.2.1.2 Rückwärts
4.2.1.3 Zickzack
4.2.1.4 Zielgerichtet
4.2.2 BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT
4.2.2.1 Langsam
4.2.2.2 Schnell
4.3 SERIE KOMBINATION
4.3.1 ZIEL STATISCH – SCHÜTZ*IN STEHEND
4.3.2 ZIEL HORIZONTAL – SCHÜTZ*IN VORWÄRTSGEHEND
4.3.3 ZIEL ZUFÄLLIG – SCHÜTZ*INE SCHNELL ZIELGERICHTET GEHEND
4.4 ZUSAMMENFÜHRUNG DER ERGEBNISSE
4.4.1 SICH BEWEGENDE ZIELE
4.4.2 SICH BEWEGENDE SCHÜTZ*INNEN
4.4.3 KOMBINATION VON SICH BEWEGENDEN ZIELEN UND SICH BEWEGENDEN SCHÜTZ*INNEN
4.4.4 KOMPONENTENZERLEGUNG
4.4.1 ZUSAMMENFASSUNG DER EINZELERGEBNISSE
4.5 EINFLÜSSE AUF DIE TREFFERLEISTUNG
4.5.1 EINFLUSS DER SCHIEßFERTIGKEIT AUF DIE TREFFERLEISTUNG
4.5.1.1 Präzisionsschießen
4.5.1.1 Grob visiertes Schießen
4.5.2 SCHIEßGESCHWINDIGKEIT
4.5.3 SCHIEßTAKTIK
5 DISKUSSION
5.1 METHODISCHES
5.1.1 VERSUCHSPERSONEN
5.1.2 VALIDITÄT DER BEWEGUNGEN UND ZIELE
5.1.3 METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR BEDINGUNGSVARIATION UND REIHENFOLGEEFFEKTEN
5.2 AUSWIRKUNG VON BEWEGUNG AUF DIE TREFFERLEISTUNG
5.3 EINFLÜSSE AUF DEN EFFEKT VON BEWEGUNG AUF DIE TREFFERLEISTUNG
5.3.1 GRUNDLEGENDE SCHIEßQUALITÄT
5.3.2 SCHIEßTAKTIK
5.3.3 SCHIEßGESCHWINDIGKEIT
5.3.4 STRESS UND GEGENFEUER
5.4 TRAINING
5.5 OFFENE FORSCHUNGSFRAGEN
6 LITERATUR
Clemens Lorei & Hermann Groß
Elektromobilität in der Polizei Hessen Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung

Im Projekt „Erprobung von uniformierten Elektrofahrzeugen bei Polizei revieren und Polizeistationen“ des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit der Laufzeit 2018-2021 sollten hilfreiche Informationen zum möglichen und sinnvollen Einsatz von uniformierten Elektrofahrzeugen im Bereich hessischer Polizeireviere und Polizeistationen als Entscheidungsgrundlage für die weitere Elektrifizierung des polizeilichen Fuhrparks gewonnen werden. Zum Projektabschluss liegen Erkenntnisse vor, die eine Klärung der Fragestellung zulassen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen uniformierte Elektrofahrzeuge ein Ersatz für konventionell betriebene Fahrzeuge darstellen können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einsatztaktischen Aspekten.
In dem hier vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse im Verlauf des Projektes zur Nutzerevaluation dargelegt. Diese umfassen die Erhebung vor Einführung mittels Onlinebefragung von Einstellungen, Akzeptanzaspekten und Erwartungen von potenziell betroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Mit diesen Erwartungen vor der Einführung werden die Erfahrungen nach bis zu einem Jahr Nutzung verglichen. Darüber hinaus werden dann Erfahrungen berichtet die, mittels Interviews und teilnehmenden Beobachtungen gewonnen wurden.
Inhalt
Inhalt:
1 Ziel
2 Allgemeine Methodik
2.1 Erhebung mittels Fragebögen
2.2 Interviews
2.3 Teilnehmende Beobachtung
3 Theoretischer Hintergrund
3.1 Aspekte privater Nutzung
3.2 Aspekte gewerblicher Nutzung
3.3 Erfahrungen im Polizeibereich
3.4 Fragebögen zu Einflussfaktoren auf die Akzeptanz
4 Fragebogen zu Beginn der Einführung
4.1 Ansprache zu Beginn des Fragebogens
4.2 Soziodemographie & Kodierung
4.3 (Vor)erfahrungen Elektromobilität
4.4 Einstellungsorientierte Akzeptanzanalyse
4.5 polizeiliche Akzeptanzkriterien
4.6 Planbarkeit von Fahrten
4.7 Mobilitätsbedarf
4.8 Erwartungen
4.9 Usability
4.10 Laden
4.11 Öffentlichkeitswirkung / Bürgerfeedback aus Nutzersicht
4.12 Änderungen durch die Einführung
4.13 Verbesserungswünsche
5 Methode der Befragung vor der Einführung
5.1 Untersuchungspersonen
5.2 Befragung
5.3 Rücklauf
6 Befragungsergebnisse vor der Einführung
6.1 Soziodemographie
6.2 Einstellungsorientierte Akzeptanzanalyse
6.3 polizeiliche Akzeptanzkriterien
6.4 Planbarkeit von Fahrten
6.5 Mobilitätsbedarf
6.6 Erwartungen
6.7 Usability der Fahrzeuge
6.8 Laden
6.9 Öffentlichkeitswirkung / Bürgerfeedback aus Nutzersicht
6.10 Änderungen durch die Einführung
6.11 Verbesserungswünsche
6.12 Meinung zum Einsatz weiterer Elektrofahrzeuge im Fuhrpark der Polizei Hessen zum jetzigen Zeitpunkt
6.13 Zusammenhänge
6.14 Fazit der Befragung zum Einführungszeitpunkt
7 Fragebogen am Ende der Erprobung
7.1 Ansprache zu Beginn des Fragebogens
7.2 Soziodemographie & Kodierung
7.3 (Vor)erfahrungen Elektromobilität
7.4 Dienstliche Erfahrung
7.5 Einstellungsorientierte Akzeptanzanalyse
7.6 polizeiliche Akzeptanzkriterien
7.7 Planbarkeit von Fahrten
7.8 Veränderungen durch Einführung der Elektromobilität
7.9 Mobilitätsbedarf
7.10 Erfahrungen und Erwartungen
7.11 Usability
7.12 Laden
7.13 Öffentlichkeitswirkung / Bürgerfeedback aus Nutzersicht
7.14 Änderungen durch die Einführung
7.15 Verbesserungswünsche
7.16 Bewertung der Inhalte des Schulungskonzeptes
7.17 Bewertungen von Aspekten der Einführung
8 Methode der Befragung am Ende der Einführung
8.1 Untersuchungspersonen
8.2 Befragung
8.3 Zeitpunkt der Erhebung
8.4 Rücklauf
9 Befragungsergebnisse zum Zeitpunkt nach der Einführung
9.1 Soziodemographie & Kodierung
9.2 Einstellungsorientierte Akzeptanzanalyse
9.3 polizeiliche Akzeptanzkriterien
9.4 Planbarkeit von Fahrten
9.5 Subjektive Veränderungen im Dienstbetrieb mit der Einführung von E-Fahrzeugen
9.6 Mobilitätsbedarf
9.7 Erfahrungen & Erwartungen
9.8 Usability
9.9 Laden
9.10 Öffentlichkeitswirkung / Bürgerfeedback aus Nutzersicht
9.11 Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung und der Experteninterviews
9.12 Änderungen durch die Einführung
9.13 Verbesserungswünsche
9.14 Bewertung der Inhalte des Schulungskonzeptes
9.15 Bewertungen von Aspekten der Einführung
10 Hauptergebnisse nach der Einführung
10.1 Evaluationsergebnisse in Thesen
10.2 Zusammenfassung der Hauptergebnisse
11 Empfehlung
12 Literatur
13 Publikationen aus dem Projekt
Marcel Müller
Umgang mit Differenz am Beispiel von Verkehrskontrollen Eine auto-ethnografische Forschung im Rahmen der Ausbildung von Kommissar-Anwärter/innen
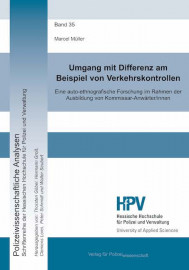
In der Polizei-Bürger-Interaktion müssen Polizist/innen häufig dynamisch und lageangepasst zwischen den Registern Kommunikation und Zwang wechseln. Das Spannungsverhältnis beider Register, welches durchaus als wesentliches Dilemma polizeilichen Handelns zu bezeichnen ist, wird insbesondere in multilingualen Einsätzen sichtbar. In dieser Studie geht es deshalb um die Frage, wie sich sprachliche Differenzen – vorliegend am Beispiel einer Verkehrskontrolle – auf die polizeiliche Praxis auswirken und wie Polizist/innen mit solchen Situationen umgehen. In diesem Kontext ist vor allem von Interesse, welche Ansätze und Strategien die Polizeibeamt/innen verfolgen, um die auftretenden (Verständnis-)Probleme im Rahmen der Kontrolle zu lösen und was geschieht, wenn es ihnen (scheinbar) nicht gelingt, die auftretenden Sprachbarrieren zu überwinden. Hieran anknüpfend ist von Interesse, welche Faktoren die Kommunikation der Beamt/innen mit dem Gegenüber beeinflussen, welche Konsequenzen das Handeln der Polizist/innen nach sich ziehen kann und was schließlich charakteristisch für solche Situationen ist.
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
2. Methodik
2.1 Inszenierte Interaktion
2.2 Reenactment als ethnografische Methode
2.3 Das Interview
2.4 Fokussierte Ethnografie
2.5 Kollaborativer und interdisziplinärer Forschungsansatz
2.6 Beschreibung der Stichprobe
2.7 Das Ausgangsszenario
3. Missverständnisse infolge des Nicht-Verstehens
3.1 Kommunikation im Team
3.2 Außenwirkung (der Polizei) und Rollenerwartungen (des Bürgers)
3.3 Der Common Sense einer Verkehrskontrolle
3.4 (Miss-)Verständnis aufgrund von kulturellem (Un-)Wissen
4. Der Kommunikationsmodus: Wertschätzung und Empathie
4.1 Ideenreichtum und Kreativität
5. Schlussfolgerungen: Kommunikationsmodus vs. Zwangsmodus in der polizeilichen Interaktion
6. Literaturverzeichnis

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Nicht nur, dass er gerne in Gesellschaft ist, in Beziehungen Glück findet und in Gemeinschaften Ziele erreicht, die er alleine nicht vermag, so steht sogar seine physische wie psychische Gesundheit in enger Verbindung mit anderen. Wird die alltägliche Belastung hoch oder widerfährt einem sogar Traumatisches, so gewinnen andere Menschen durch ihre soziale Unterstützung immer mehr an Bedeutung. Sie sind es, die durch direkte Hilfe, Mitgefühl, Feedback oder Geborgenheit Unterstützungsempfänger Stress besser bewältigen lassen.
Eine Berufssparte, die als mit Arbeitsbezogenen Stress sehr belastet gilt, ist der Polizeiberuf. Aus diesem Grunde kann soziale Unterstützung für Polizeibeamte eine hohe Bedeutung erlangen. Eindeutig ist dabei die Wirkung und Bedeutung Sozialer Unterstützung für Polizeibeamte gezeigt.
Offen ist jedoch, ob die soziale Unterstützung bei Polizisten quantitativ und qualitativ der anderer Bevölkerungsgruppen entspricht. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es deshalb zu prüfen, ob Polizisten über eine von anderen Gruppen abweichende Struktur von Sozialer Unterstützung verfügen und wie sich diese im Laufe der Sozialisation in den Beruf entwickelt.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Effekte sozialer Unterstützung
2.1.1 Gesundheit allgemein
2.1.2 Depression
2.1.3 Burnout
2.1.4 Traumata
2.1.5 Stressbewältigung
2.1.6 Aspekte der Arbeit
2.2 Negative Seiten sozialer Unterstützung
2.3 Moderatoren
2.4 Struktur der sozialen Unterstützung
2.5 Ergebnisse von Studien bei der Polizei
3 Ziele der Untersuchungen und Hypothesen
3.1 Vergleich der Struktur Sozialer Unterstützung von Polizeibeamten mit nicht Polizisten
4 Methode
4.1 Instrument
4.1.1 Aktuelles Stresslevel
4.1.2 Fragebogen zur sozialen Unterstützung
4.1.3 Skala sozialer Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kollegen und Vorgesetzte
4.1.4 Items zur negativen sozialen Unterstützung
4.1.5 Einstellung zum Zeigen von Emotionen
4.1.6 Kohäsion mit Kollegen, Organisation und Gesellschaft
4.1.7 Subjektives Weltbild
4.2 Stichproben
4.2.1 Polizei-Studierende
4.2.2 Studierende anderer Fachrichtungen
4.3 Befragung
4.3.1 Polizei-Studierende
4.3.2 Studierende anderer Fachrichtungen
4.4 Auswertung
5 Deskriptive Ergebnisse
5.1 Polizei-Studierende
5.1.1 Beziehungsstatus
5.1.2 Freizeitgestaltung
5.1.2.1 Sport
5.1.2.2 Freundeskreis
5.1.2.3 Vereinsleben
5.1.3 aktuelles Stresslevel
5.1.4 soziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kollegen und Vorgesetzte
5.1.5 Einstellung zum Zeigen von Emotionen
5.1.6 Kohäsion mit Kollegen, Organisation und Gesellschaft
5.1.7 Subjektives Weltbild
5.1.8 wahrgenommene sozialen Unterstützung
5.1.9 Struktur sozialer Unterstützung
5.2 Studierende anderer Fachrichtungen
5.2.1 Beziehungsstatus
5.2.2 Freizeitgestaltung
5.2.2.1 Sport
5.2.2.2 Freundeskreis
5.2.2.3 Vereinsleben
5.2.3 aktuelles Stresslevel
5.2.4 soziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kollegen und Vorgesetzte
5.2.5 Einstellung zum Zeigen von Emotionen
5.2.6 Kohäsion mit Kollegen, Organisation und Gesellschaft
5.2.7 Subjektives Weltbild
5.2.8 wahrgenommene sozialen Unterstützung
5.2.9 Struktur sozialer Unterstützung
6 Vergleiche
6.1 Vergleich Polizei-Studierende - Studierende anderer Fachrichtungen
6.1.1 Lebenssituation
6.1.2 Soziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kollegen und Vorgesetzte
6.1.3 Einstellung zum Zeigen von Emotionen
6.2.4 Kohäsion mit Kollegen, Organisation und Gesellschaft
6.2.5 Subjektives Weltbild
6.2.6 wahrgenommene Sozialen Unterstützung
6.2.7 Struktur sozialer Unterstützung
7 Zusammenhänge mit der Sozialen Unterstützung
7.1 Lebenssituation
7.2 Einstellung zum Zeigen von Emotionen
7.3 Kohäsion mit Kollegen, Organisation und Gesellschaft
7.4 Subjektives Weltbild
8 Diskussion
8.1. Zur Methode
8.2 Vergleich der Struktur Sozialer Unterstützung von Polizeibeamten mit nicht Polizisten
8.2.1 Vergleich Polizeistudierender - Studierende andere Fachrichtungen
8.2.1.1 Unterschiede in der Soziale Unterstützung
8.2.1.2 Unterschiede in Moderationsfaktoren der Sozialen Unterstützung
9 Fazit
9.1 Vergleich Polizei - Nicht-Polizei hinsichtlich Sozialer Unterstützung
9.2 Entwicklung der Struktur Sozialer Unterstützung
9.3 Einflussfaktoren auf die Soziale Unterstützung
9.4 Praxisimplikationen
Literatur

Der Polizeiberuf ist anspruchsvoll – immer wieder kommt man als Polizeibeamtin und Polizeibeamter in Situationen, in denen das polizeiliche Ziel nicht einfach zu erreichen ist, in denen Konflikte mit dem Gegenüber ausgetragen werden müssen oder in denen man an die Grenzen seiner Möglichkeiten stößt. Erfolgreiche Polizistinnen und Polizisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie gerade auch in solchen Situationen, die scheinbar kaum zu lösen sind, Lösungen (ver-)suchen und auch teilweise finden. In schwierigen Konfliktsituationen mit einem Gegenüber kann mitunter der Einsatz von Gewalt vermieden werden indem geschickt kommuniziert wird.
Andere schwierige Situationen existieren, in denen übliche polizeiliche Handlungen und Methoden zu Erreichung des polizeilichen Ziels nicht erfolgreich sind. Hier kann der Einsatz von ungewöhnlichen Alternativen und Strategien mitunter helfen.
Diese beiden Aspekte wie Polizei auf unterschiedlichen Wegen ihr Ziel erreicht sind wissenschaftlich noch wenig betrachtet. Die hier vorliegenden Studien, die in Hessen und Österreich durchgeführt wurden, stellen deshalb dieses Einsatzhandeln in ihren Fokus.
Inhalt
Inhalt:
Clemens Lorei
1 Einleitung
Clemens Lorei, Kerstin Kocab & Karoline Ellrich
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Polizei & Gewalt
2.2 Kommunikation
2.3 Deeskalation
Clemens Lorei, Kerstin Kocab & Karoline Ellrich
Studie 1 in Hessen
3 Methode
3.1 Befragte Personen
3.2 Erhebung
3.3 Auswertung
4 Ergebnisse
4.1 Kategorie Kommunikation
4.2 Kategorie Alternativen
4.3 Metaergebnisse
5 Fazit der Studie 1 in Hessen
5.1 Polizeiliche deeskalierende Kommunikation
5.2 Kriterien „guter polizeilicher Kommunikation“ bzw. „guter Einsatzlösungen“
5.3 Aus- und Fortbildung
5.4 Methodik
Clemens Lorei & Thomas Greis
Studie 2 in Österreich
6 Methode
6.1 Befragte Personen
6.2 Erhebung
6.3 Auswertung
7 Ergebnisse
7.1 Prämierung
7.2 Eingesetzte Kommunikationstechniken
7.3 Fazit eingesetzte Kommunikationstechniken und kommunikative Aspekte
7.5 Metaergebnisse
8 Fazit Studie 2 Österreich
8.1 Polizeiliche deeskalierende Kommunikation
8.2 Kriterien „guter polizeilicher Kommunikation“ bzw. „guter Einsatzlösungen“
8.3 Aus- und Fortbildung
8.4 Methodik
9 Literatur
10 Anhang

Inhalt
Vorwort
1. Einleitung / Historie
2. Projektgegenstand/ -ziele /-verlauf (Übersicht)
2.1 Projektverlauf (Gesamtüberblick)
2.2 Projektgegenstand/ -ziele
2.2.1 Blutspurenmusteranalyse allgemein
2.2.2 Qualifizierte Spurensicherung
2.2.3 BPA-Potentiale für Ermittlung / Fahndung
2.2.4 Gutachtenkomplex
2.2.4.1 Grundsätzliche Voraussetzungen für die BPA-Beauftragung
2.2.4.2 Konkretisierung / Durchführung der Beauftragung
2.2.4.3 Kompetenz des Gutachters
2.3 BPA-Auswirkungen auf gerichtliche Verfahren
3. Einzelprojekte
3.1 Teilprojekt I (Fallakten / Thesis)
3.1.1 Methoden
3.1.2 Ergebnisse
3.2 Teilprojekt II (Ausbildungskonzept)
3.2.1 Projektgegenstand /-ziel
3.2.2 Methoden
3.2.3 Ergebnisse
3.2.3.1 BKA / LKA
3.2.3.2 Institute für Rechtsmedizin
3.2.3.3 Blutspureninstitut Usingen
3.2.3.4 2. Fragebogenaktion IG BPA
3.2.3.5 2. Fragebogenaktion AG „Blutspuren-Verteilungsmuster“ der DGRM
3.2.3.6 2. Fragebogen BSI Usingen
3.2.3.7 Hessische Erkennungsdienste / Fachkommissariate
3.3 Teilprojekt III (Kategorisierung / Terminologie)
3.3.1 Erste Ansätze: J. Radziki 1960
Herbert L. MacDonell 1971
3.3.2 S.H. James 1999
3.3.3 Bevel / Ross / Gardner 2002
3.3.4 James / Kish / Sutton 2005
3.3.5 BSI – Brodbeck – 2009 / 2011
3.3.6 Ramsthaler et al. 2015
4 Kriminalistische Relevanz der BPA
4.1 Passive Entstehungsmuster
- Passive Tropfspuren (Drip Trail)
- Fluss-/ Abrinnspuren (Flow Pattern)
- Sättigungsbedinge Spur (Saturation)
- Blutlache / große Volumina / Pool
4.2 Transfer-/ Kontaktspuren (Transfer Stain)
- Abdruckspur (Contact Pattern)
- Wischspur (Wipe Pattern)
- Abstreifmuster (Swipe Pattern)
4.3 Projizierte Blutspuren / Spritzfelder (Projected Pattern)
- Aktive Einwirkungs-/ Auftreff-Spritzmuster
(Impact Pattern - Area of Convergence - Area of
Origin)
- Sekundäre Entstehungsmechanismen / Satellitenspritzer (Satelite Spatter)
- Projizierte Muster (Projection Mechanism)
- Abwurfspuren (Cast-off Pattern)
- Verletzung großer Blutgefäße
- Ausatmungsmuster (Expiration Pattern)
4.4 Sonstige Spuren (Altered) 125
- Geronnenes Blut (Clot)
- Verdünntes Blut (Diluted)
- Diffusion (Diffuse)
- Insektenartefakte (Insect Stain)
- Aussparungen (Void)
- Sequenzierungen (Sequences)
- Serumspur (Serum Stain)
5 Gesamtergebnisse / Ausblick

etc.) und Polizeiangehörige mit Nachweis.
Der polizeiliche Schusswaffengebrauch stellt wahrscheinlich die gravierendste Eingriffsmaßnahme dar, die ein Polizeibeamter treffen kann. Aus diesem Grund muss er hierauf unbedingt umfassend und nach besten Möglichkeiten vorbereitet werden, um entsprechende Gefahren für sich oder andere abwehren zu können und Unbeteiligte keiner Gefährdung auszusetzen. Die in diesem Band dokumentierten Studien wollen deshalb dazu beitragen, die wissenschaftliche Diskussion um den polizeilichen Schusswaffengebrauch anzuregen und helfen, die Schießaus- und -fortbildung bzw. das gesamte Einsatztraining zu optimieren.
Inhalt
Clemens Lorei
Mehr als eine Dekade „neue Polizeimunition“ – evaluative Überlegungen
Clemens Lorei & Rudi Heimann
Schießen auf Flüchtende - Eine Replikation
Clemens Lorei, Bernd Grünbaum, Wolfgang Spöcker & Sven Spitz
Schnell
Schießen oder genau Treffen?
Zur Abhängigkeit von Schießgeschwindigkeit und Treffgenauigkeit

Immer wieder wird das so genannte „Jagdfieber“, der „Jagdtrieb“ oder auch der „Jagdinstinkt“ als Erklärung herangezogen, wenn polizeiliches Handeln übertrieben oder unverhältnismäßig erscheint und zu Schäden und Unfällen führt. Damit ist jedoch nichts erklärt. Es wird höchstens ein Phänomen benannt, welches tödliche Konsequenzen haben kann: Verfolgungsfahrten enden in schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten oder sogar Toten, Festnahmen in Gewaltexzessen oder Verfolgungen zu Fuß in der Tötung von Polizisten enden. Um Erklärungen zu finden und Gegenmaßnahmen zu erarbeiten, wurde bereits eine Forschungsreihe durchgeführt. Durch Rückmeldungen dazu wurde das Forschungsinteresse weiter verstärkt und die Motivation intensiviert, noch mehr über das spezielle polizeiliche Einsatzverhalten zu erfahren. Entsprechend wurden dann in Ansätzen bereits behandelte Aspekte wiederholt oder modifiziert betrachtet und neue Perspektiven in den Forschungsfokus genommen. Diese Studien werden im hier vorliegenden Sammelband vorgestellt und der fachlichen Diskussion angeboten.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Clemens Lorei, Heinz Walter Müller & Peter Faesel
Polizeiliche Verhaltensunterschiede zwischen Auftrags- und Befehlstaktik
Eine erste empirische Annäherung
Clemens Lorei & Peter Faesel
Der Einfluss der Auftrags- und Befehlstaktik auf das polizeiliche Jagdfieber – Ergebnisse einer Replikation
Clemens Lorei
Der Effekt von vor dem Einsatz formulierten Abbruchkriterien auf das polizeiliche Jagdfieber – Wiederholung eines Ansatzes zur überwindung des Jagdfiebers
Clemens Lorei
Reanalyse einer Jagdfieberstudie hinsichtlich eines möglichen Einsatzabbruches bzw. Rückzuges
Clemens Lorei & Wolfgang Spöcker
Der Einfluss von Distanz auf das polizeiliche Jagdfieber
Josephine Jellen & Clemens Lorei
Reanalyse von Jagdfieberstudien - Nachträgliche Bewertung des Einsatzverlaufs und deren Begründungsstruktur
Clemens Lorei, Rudi Heimann & Josephine Jellen
Einsatzbewertung in Abhängigkeit des Ausganges oder der Handlungen
Clemens Lorei, Max Hermanutz, Wolfgang Spöcker & Sven Litzcke
Cop-Culture und Jagdfieber
Clemens Lorei, Sven Litzcke, Max Hermanutz & Wolfgang Spöcker
Jagdfieber – Ein Vergleich von Polizisten mit Nicht-Polizisten
Clemens Lorei & Julia Hartmann
Der Einfluss von ‚Ego-Depletion’ auf das Einsatzverhalten
Clemens Lorei & Peter Faesel
Der Einfluss von versunkenen Kosten (‚Sunk Costs’) auf das polizeiliche Jagdfieber
Clemens Lorei & Peter Faesel
Zielerreichungsnähe und Jagdfieber
Clemens Lorei
Zusammenfassung und Fazit