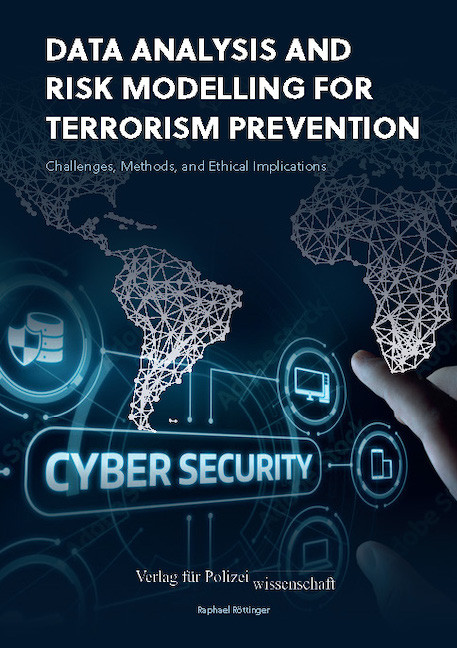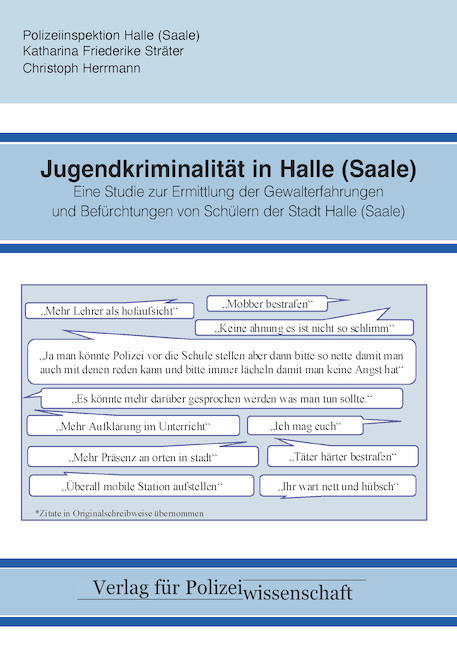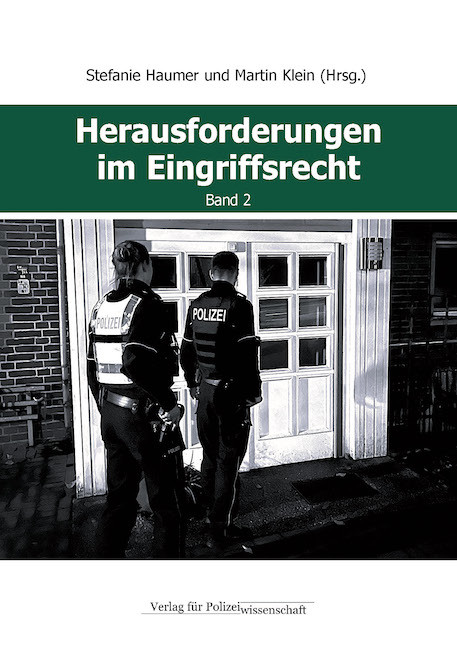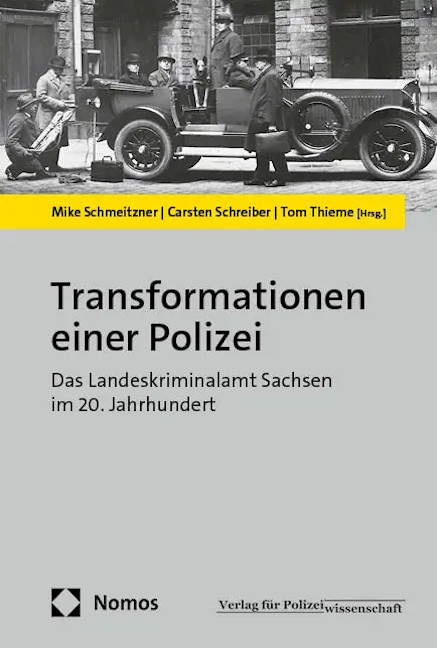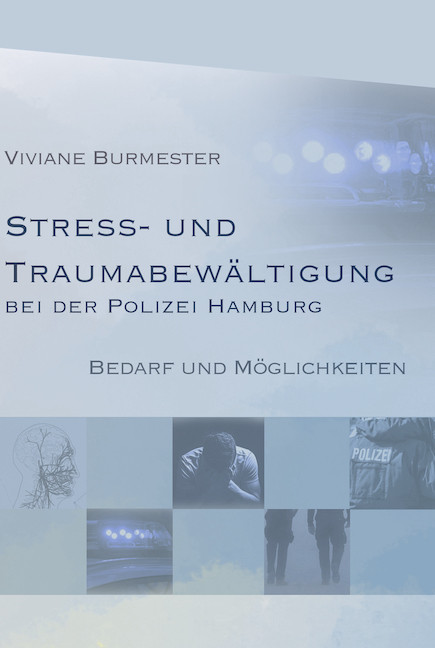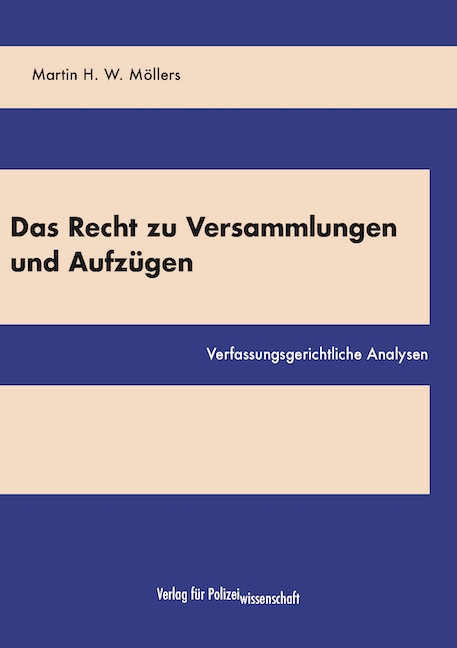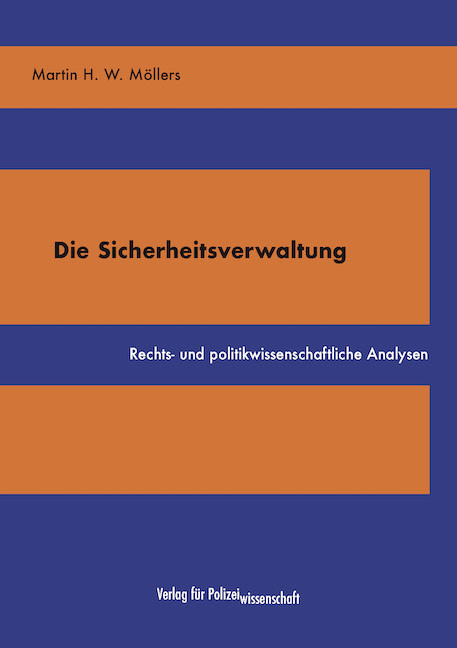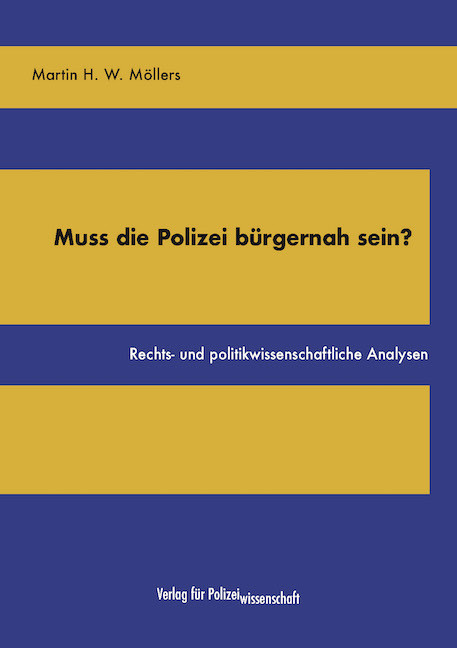Raphael Röttinger
Data Analysis and Risk Modelling for Terrorism Prevention: Challenges, Methods, and Ethical Implications
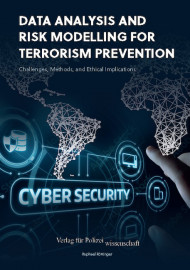
Inhalt
Inhalt:
1 Introduction
1.1 Problem definition and research question
1.2 Objectives and approach
2 Literature research - data analysis in the context of terrorism prevention
2.1 Data science and artificial intelligence
2.2 Data analysis models
2.3 Modern terrorism
2.4 Factors in the prevention of terrorism
2.5 Challenges in data analysis
2.6 Hypotheses and concept of the work
3 Methodology and data basis
3.1 Data records
3.2 Methodological approach
3.3 Research ethics
4 Analysis model and interpretation
4.1 Data processing and preparation
4.2 Cluster and classification analysis
4.3 Deep learning
4.4 Visualisation of the results
5 Discussion
5.1 Feasibility and technical realisation
5.2 Interpretation of the results and recommendations for action
6 Conclusion
IV Bibliography
Polizeiinspektion Halle (Saale), Katharina Friederike Sträter & Christoph Herrmann
Jugendkriminalität in Halle (Saale) Eine Studie zur Ermittlung der Gewalterfahrungen und Befürchtungen von Schülern der Stadt Halle (Saale)

Dabei ist jedoch kritisch zu betrachten, dass die Entwicklung des 9-Punkte-Plans einer Art Top-down-Ansatz folgte: Die Jugendlichen der Saalestadt wurden im Zuge der Diskussionen um mögliche situationsverbessernde Maßnahmen weder befragt noch anderweitig umfassend am Entwicklungsprozess des 9-Punkte-Plans beteiligt. Um diese Lücke zu schließen, entwickelte die Polizeiinspektion Halle (Saale) eigeninitiativ eine Befragungsstudie, durch welche Informationen über das Gewalterleben in der Schule, auf dem Schulweg und in der Freizeit aus Perspektive der Jugendlichen erfasst werden sollten. Ziel der Erhebung war es, die Erfahrungen der Jugendlichen zum Zweck der Optimierung polizeilichen Handelns zu nutzen. Folglich wurde die Umfrage zunächst nicht auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Anspruchs, sondern aufbauend auf polizeipraktischen Fragestellungen von Akteuren der Polizei entwickelt, implementiert und durchgeführt.
Befragt wurden mehr als 3.000 Schüler in Halle (Saale) im Alter zwischen 13 und 18 Jahren
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
2 Das Sicherheitsgefühl – ein schwer greifbares Konstrukt
3 Jugendkriminalität – eine Einordnung
4 Risikofaktoren
4.1 Risikofaktoren – eine exemplarische Perspektive
4.2 Betrachtung exogener Risikofaktoren für die Stadt Halle (Saale)
5 Jugendkriminalität in der Stadt Halle (Saale)
5.1 Jugendkriminalität in Halle (Saale) – Zahlen und Fakten
5.2 Der 9-Punkte-Plan
5.3 Die BAO „Cornern“
6 Motivation der Befragungsstudie
7 Methodik
7.1 Fragebogendesign und Datenerhebung
7.2 Datenaufbereitung
7.3 Datenauswertung
8 Ergebnisse
8.1 Beschreibung der Stichprobe
8.2 Themenbezogene Ergebnisse der geschlossenen Fragen
8.2.1 Deliktarten
8.2.2 Zeiten und Orte, die mit Gewalt assoziiert sind
8.2.3 Täterkreis
8.2.4 Gewaltbezogene Erlebnisse in der Freizeit
8.2.5 Zeiten des Gewalterlebens in der Freizeit
8.2.6 Vergleich wahrgenommener Straftaten im Kontext von Schule und Freizeit
8.2.7 Anzeigeverhalten
8.3 Themenbezogene Ergebnisse der offenen Fragen
9 Diskussion
10 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
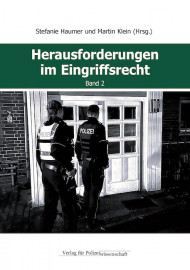
Die derzeit im Fokus stehenden Themen sind vielfältig: Sie reichen von allgemeinen Herausforderungen in der Praxis über rechtliche Herausforderungen in speziellen Bereichen wie dem Versammlungsrecht, Fragen rund um die (digitale) Erhebung personenbezogener Daten, den Umgang mit verdeckten polizeilichen Maßnahmen, bis hin zum Opferschutz.
Inhalt
Inhalt:
Aktuelle Herausforderungen im Strafverfahrensrecht – Eingriffsrechte in der Praxis
Katrin Lauxtermann/Johanna Frederike Herberg
„From the river to the sea“ – Zum repressiven Vorgehen gegen umstrittene Parolen bei Versammlungen in Nordrhein-Westfalen
Stefanie Haumer
Die Einwilligung in strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen im Lichte des aktuellen Datenschutzrechts
Frank Hofmann
Die Erhebung von Nutzungsdaten bei Anbietern von digitalen Diensten – Eine Frage der Mitwirkung privater Akteure?
Magali Böger/Julius Böger
Online-Durchsuchung, Telekommunikationsüberwachung & Co
Frank Braun
Erkennungsdienstliche Behandlung zum Zwecke der Strafverfolgungsvorsorge
Christoph Keller
Die Verwertbarkeit von Bodycam-Aufnahmen im Strafprozess in Nordrhein-Westfalen
Martin Klein
Rechtliche Anforderungen an das Betreten von Wohnungen im Rahmen von Personenfahndungsmaßnahmen
Wiebke Kaiser
Nemo-tenetur-Grundsatz und Menschenrechte
Manuel Brunner
Die gesetzliche Regelung des Einsatzes von V-Personen im Strafverfahren
Florian Zenger
Polizeiliche Tatprovokation – Gesetzliche Regelung ante portas
Christoph Buchert
Opferschutz im Spannungsverhältnis zwischen Vertrauensbildung und strafprozessualen Zwängen
Lucie Tonn/Kathrin Wick-Rentrop
Mike Schmeitzner, Carsten Schreiber & Tom Thieme (Hrsg.)
Transformationen einer Polizei Das Landeskriminalamt Sachsen im 20. Jahrhundert
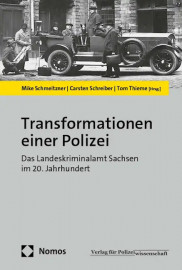
Polizeigeschichte als Transformationsgeschichte nimmt dabei die Umbruchszeiten ins Visier, die Kontinuitäten und Brüche bei den Übergängen der Institution und ihrer Akteure von einem politischen System ins nächste. Welche Rolle hatte die Kriminalpolizei bei der Durchsetzung der beiden Diktaturen in NS-Staat und DDR? Und wie gingen nach deren Fall ihre politischen Nachfolger mit dem Personal der Diktatur um? Interdisziplinär vereint der Band geschichtswissenschaftliche, politikwissenschaftliche und soziologische Perspektiven.
Inhalt
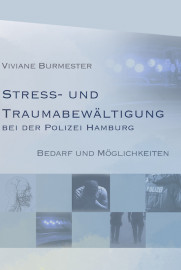
Diese Forschungsarbeit hat untersucht, was Polizist:innen der Polizei Hamburg als belastend erleben und welche Bewältigungsstrategien sie nutzen. Es wurde untersucht, welche Faktoren die Bewältigung belastender Erfahrungen fördern bzw. dies verhindern und was Polizist:innen sich für den zukünftigen Umgang mit Belastungen bei der Polizei wünschen.
Basierend auf den empirischen Ergebnissen präsentiert diese Arbeit ein praxisnahes Handlungskonzept, das die Polizei dabei unterstützen kann, ihre Strukturen zur Bewältigung von Stress und Traumatisierung zu stärken.
Inhalt
Inhalt:
1 Theoretischer Hintergrund
1.1 Psychische Belastungen bei der Polizei
1.2 Stress und Trauma aus der Perspektive des Nervensystems
1.3 Unterstützungsangebote zur Stress- und Traumabewältigung
1.4 Hindernisse zur Bewältigung belastender Ereignisse
1.5 Förderliches zur Bewältigung belastender Ereignisse
1.6 Relevanz und Fragestellung
2 Methodik
2.1 Forschungsdesign
2.2 Erhebungsinstrumente
2.3 Stichprobenbeschreibung
2.4 Datenerhebung
2.5 Datenauswertung
2.6 Ethische Aspekte
3 Ergebnisse
3.1 Belastungserleben
3.2 Bewältigungsstrategien
3.3 Der Körper bei Stress
3.4 Körperwahrnehmung
3.5 Selbstregulation
3.6 Allgemeiner Umgang mit Emotionen
3.7 Wut
3.8 Angst
3.9 Funktionale Dissoziation
3.10 Co-Regulation
3.11 Werte und Normen
3.12 Professionalität
3.13 Veränderung im Umgang mit Belastungen
3.14 Hindernisse zur Bewältigung von
3.15 Förderliches zur Bewältigung von Belastungen
3.16 Wünsche bezüglich psychologischer Unterstützung
3.17 Traumasensible Grundhaltung
3.18 Vorgesetzte
4 Diskussion
4.1 Beantwortung der Fragestellungen
4.2 Praktische Implikationen
5 Limitationen und Ausblick
6 Literaturverzeichnis
Anhang
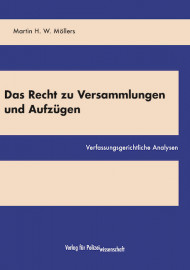
An den Entscheidungen zur Versammlungsfreiheit lässt sich deutlich erkennen, dass das BVerfG zwischen dem Schutz der Grundrechte und der Funktionsfähigkeit des Staates oszilliert. Dabei scheut sich das Gericht nicht, eigene rechtspolitische Auffassungen in ihren Urteilen unterzubringen. Das Buch dokumentiert auszugsweise maßgebliche Entscheidungen zur Versammlungsfreiheit, die ausführlich kommentiert werden.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Einführung in die Grundrechte-Rechtsprechung des BVerfG
1 Einleitung zur Menschenwürde und der Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflichten
2 Die Grundrechte-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
,Rechtsprechungstradition‘, ,Zeitgeist‘ und ,Staatsräson‘ in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit seit dem Brokdorf-Beschluss
1.1 Leitsätze
1.2 Aus den Gründen
1.3 Beteiligte Richter
2 Die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit in der vorkonstitutionellen deutschen Tradition
3 Der Brokdorf-Beschluss als Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts
3.1 Die Versammlungsfreiheit als demokratisches Teilhaberecht
3.2 Verfassungsrechtliche Anforderungen an Beschränkung, Verbot und Auflösung einer Versammlung
3.3 Kritische Würdigung des Brokdorf-Beschlusses
4 Die Folgewirkungen des liberalen Brokdorf-Beschlusses auf spätere Entscheidungen des BVerfG zur Versammlungsfreiheit
4.1 Die aktuelle Entscheidung des BVerfG zur Aufhebung eines Versammlungsverbots
4.2 Die Änderung des Versammlungsgesetzes
Das Sonderrecht bei Meinungsäußerungen von Rechtsextremisten im Wunsiedel- und Bielefeld-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 2150/08 vom 4.11.2009, Abs. 1-110 – Wunsiedel-Beschluss [Auszug]
1.1 Leitsätze
1.2 Aus den Gründen
1.3 Beteiligte Richter
2 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 2636/04 vom 12.5.2010, Abs. 1-32 – Bielefeld-Kammerbeschluss [Auszug]
2.1 Aus den Gründen
2.2 Beteiligte Richter
3 Einführende Anmerkungen zu beiden Entscheidungen
4 Die Entscheidungsbedeutung des Wunsiedel-Beschlusses
5 Der Bielefeld-Beschluss im Lichte von ,Wunsiedel‘
6 Quintessenz und Ausblick
Die Fraport-Entscheidung des BVerfG zur Stärkung des Demonstrationsrechts in Flughäfen, Bahnhöfen und in Einkaufszentren
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011, Abs. 1-128 – Fraport-Urteil [Auszug]
1.1 Leitsätze
1.2 Aus den Gründen
1.3 Beteiligte Richter
1.4 Abweichende Meinung des Richters Wilhelm Schluckebier zum Urteil des Ersten Senats vom 22. Februar 2011 - 1 BvR 699/06 -
2 Die Ausgangslage der gerichtlichen Entscheidung
3 Die Leitsätze
3.1 Erweiterung der unmittelbaren Grundrechtsbindung auf gemischtwirtschaftliche Unternehmen in Privatrechtsform
3.2 Weitergehende Einschränkungen der Versammlungsfreiheit in Abfertigungshallen von Flughafengebäuden
4 Keine Begrenzung des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit auf öffentliche, der Kommunikation dienende Foren
5 Prognosen aus dem Urteil
Abkehr vom liberalen Brokdorf-Beschluss? Die Kammerentscheidung des BVerfG zur Rechtmäßigkeit eines Polizeikessels in Frankfurt am Main vom 2.11.2016
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011, Abs. 1-128 – Polizeikessel-Beschluss [Auszug]
1.1 Aus den Gründen
1.2 Beteiligte Richter
2 Einleitung zur Problematik
3 Grundlagen des Brokdorf-Beschlusses
4 Die Einkesselung als Grundrechtsproblem
5 Beurteilung des dem BVerfG vorliegenden Sachverhalts durch die Kammer
6 Bewertung des Kammerbeschlusses zum Polizeikessel und Ausblick
Autorenhinweis

Das Buch will deutlich machen, welche Sicherheitsbedrohungen der letzten Jahre seit den Terroranschlägen am 11. September 2009 (9/11) aktuell in Deutschland vorherrschen und welche Bekämpfungsstrategien der Staat entwickelt hat. Dafür werden die Handelnden der Verwaltung der öffentlichen Sicherheit in Deutschland und Europa analysiert sowie untersucht, in welchen Zusammenhängen und Strukturen die Akteure im (sicherheits-)politischen Mehrebenensystem von Ländern, Bund und Europäischer Union agieren. Dabei wird auch ermittelt, welches Netzwerk die staatlichen Akteure der Sicherheitsverwaltung den neuen Bedrohungslagen entgegenstellen.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Einführung in das Thema
1 Die Entwicklung der äußeren und inneren Sicherheit
2 Akteure, Polity, Politics und Policy der öffentlichen Sicherheit
Die Handelnden der öffentlichen Sicherheit außerhalb und innerhalb der Sicherheitsverwaltung
1 Die Akteure, die ein friedliches Zusammenleben beeinträchtigen oder sogar verhindern
2 Die Akteure, die zum Netzwerk der Sicherheitspolitik gehören
3 Das politisch-institutionelle Umfeld der öffentlichen Sicherheitsverwaltung
4 Das korrespondierende politische Umfeld der öffentlichen Sicherheitsverwaltung
5 Die Behörden des staatlichen Gewaltmonopols zur Wahrung der öffentlichen
Die Architektur der staatlichen Sicherheitsbehörden
1 Gefahrenabwehr und Strafverfolgung bei Polizei und Staatsanwaltschaft
2 Das System der zentralen Register
3 Die Strukturen nachrichtendienstlicher Tätigkeiten
4 Die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz
5 Folgen aus der Architektur der staatlichen Sicherheitsbehörden
Spezifische Herausforderungen der staatlichen Sicherheitsverwaltung
1 Die gegenwärtige Sicherheitslage
2 Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Maßnahmen
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
Prozessabläufe, Strategien und Programme der nichtmilitärischen Sicherheitspolitik
1 Grundlinien der Innenpolitik für Prozessabläufe und Strategien öffentlicher Sicherheit
2 Sicherheitspolitische Strategien der Sicherheitsverwaltung zur Durchsetzung von Maßnahmen
3 Programme der ,neuen‘ Sicherheitsarchitektur nach 9/11
Prognose zur Entwicklung der nichtmilitärischen Sicherheitspolitik
1 Aktuelle Diskussionen zu Fragen der Missachtung grundlegender Menschenrechte
2 Argumentationsraster für eine freiheitsberaubende Politik
Strategieentwurf für eine effektive Kontrolle der Sicherheitsbehörden
1 Zur Frage der streckenweisen Verwahrlosung der Sicherheitsverwaltung
2 Neuorganisation von Verfassungsschutz und Polizei?
3 Zur Diskussion: Errichtung eines ,Bundesgenehmigungsamts‘ als Kontrollstelle für Polizei und Verfassungsschutz
4 Zusammenfassung
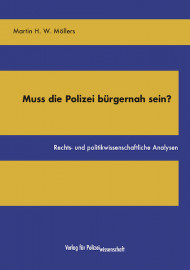
Das Buch will dazu beitragen, Bürgernähe und Kundenorientiertheit bei der Polizei zu fördern. Es setzt sich damit auseinander, was Bürgernähe ausmacht mit dem Ziel, Möglichkeiten für Bürgernähe auch durch die Digitalisierung auszuloten. Schon in der Ausbildung muss das Thema angegangen werden. Ob eine solche Ausbildung in Bürgernähe erfolgreich gewesen ist, wird durch eine Lernzielerfolgskontrolle in Form eines zu erstellenden Fragebogens überprüft. Das Buch bietet daher auch einen fertigen Fragebogen für den praktischen Einsatz.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Einführung in das Thema
1 Die Rektorenkonferenz der Verwaltungsfachhochschulen als Motor für Bürgernähe 17
2 Die Hauptfragestellungen der Untersuchung
Theoretische Grundlagen zum Untersuchungsgegenstand
1 Überblick über ausgewählte Literatur zum Verhältnis Bürger und Verwaltung 21
2 Der Begriff ,Bürgernahe Verwaltung‘ 23
3 Aufbau und Strukturen der öffentlichen Verwaltung
Chancen und Nutzen der Digitalisierung für Bürgerinnen und Bürger, für die Behörden und das Verwaltungsverfahren
1 Einleitung zum Nutzen der Digitalisierung
2 Chancen, Formen und Nutzen IT-gestützter Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung
3 Notwendige Fähigkeiten der Verwaltung und ihrem Personal für die Bewältigung der Digitalisierung
4 Die Verankerung der IT- und Medienkompetenz in der Aus- und Fortbildung
5 Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die institutionelle Selbstreflexion
Bürokratie und bürgernahe Verwaltung
1 Mögliche Ursachen der Bürokratisierung
2 Maßnahmen der Entbürokratisierung für die Bürgernähe
Inhaltliches und methodisches Konzept zur Entwicklung eines Fragebogens als Lernzielerfolgskontrolle
1 Inhaltliche Überlegungen
2 Theoretische Grundlagen zur Organisation der Lernzielerfolgskontrolle
3 Die Umsetzung des Mehrperspektivenansatzes sowie des Mehrmethoden- und Mehrebenenansatzes auf die Lernzielerfolgskontrolle
4 Die konkrete Planung der Vorgehensweise für die Lernzielerfolgskontrolle
Die Entwicklung und der Aufbau des Fragebogens zur Lernzielerfolgskontrolle
1 Die formale Konstruktion des Fragebogens
2 Der inhaltliche Aufbau des Fragebogens
Die Ausformulierung des fertigen Fragebogens zur Lernzielerfolgskontrolle
1 Statistische Angaben
2 Zur Bedeutung ,Bürgernaher, kundenorientierter Verwaltung‘
3 Kriterien und Ursachen für Mängel einer bürgernahen, kundenorientierten Verwaltung
4 Konkrete Beispiele bürgernaher Verwaltung
5 Die Zukunft der bürgernahen, kundenorientierten Verwaltung in der Ausbildung