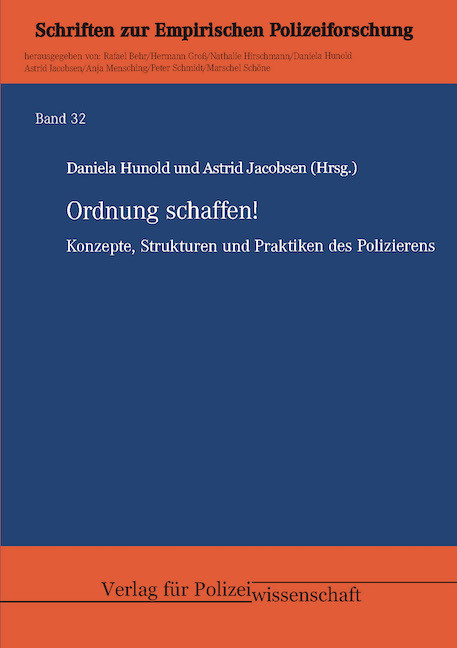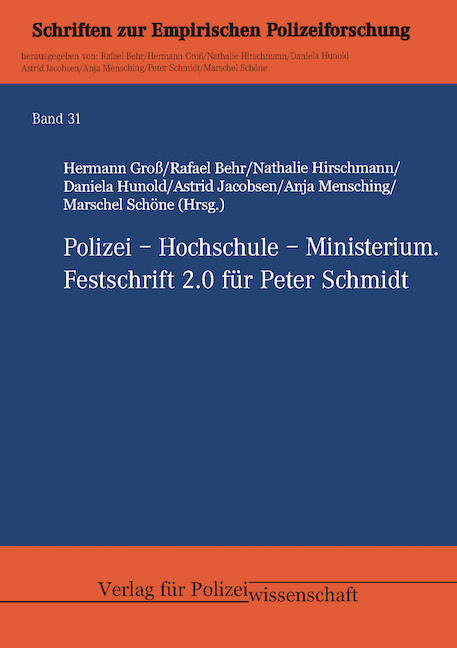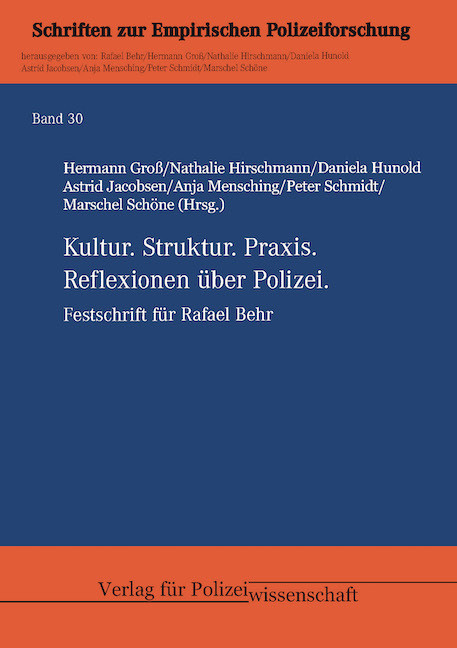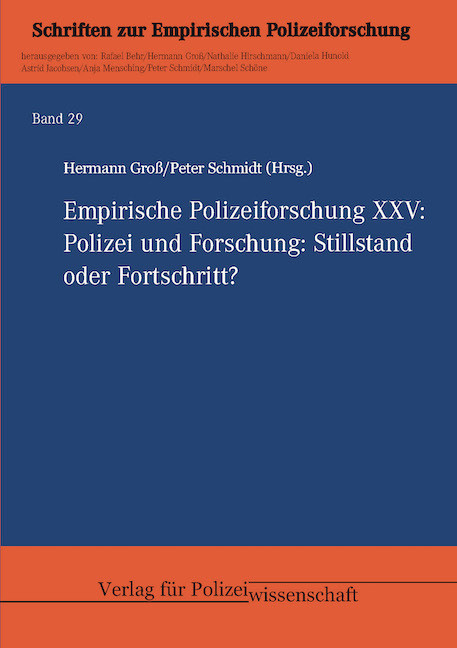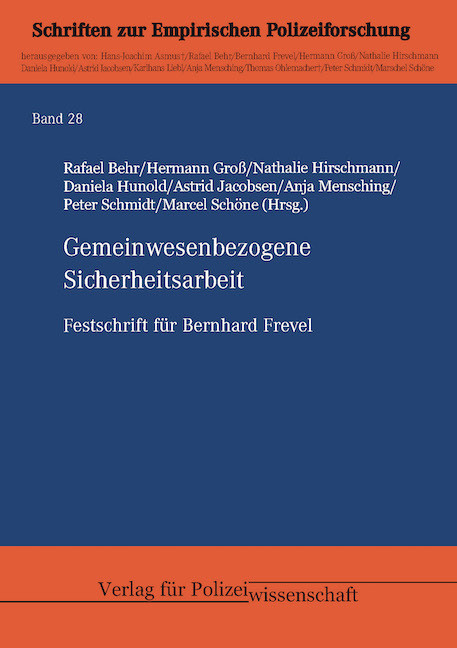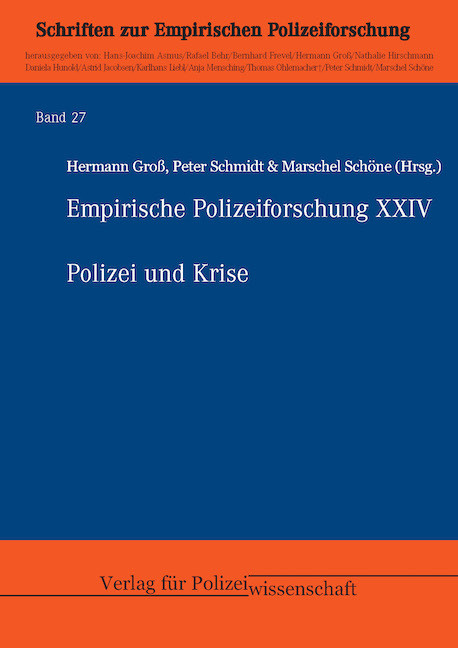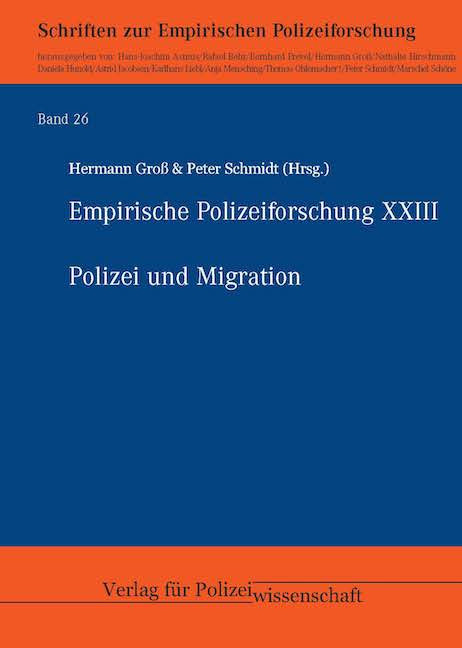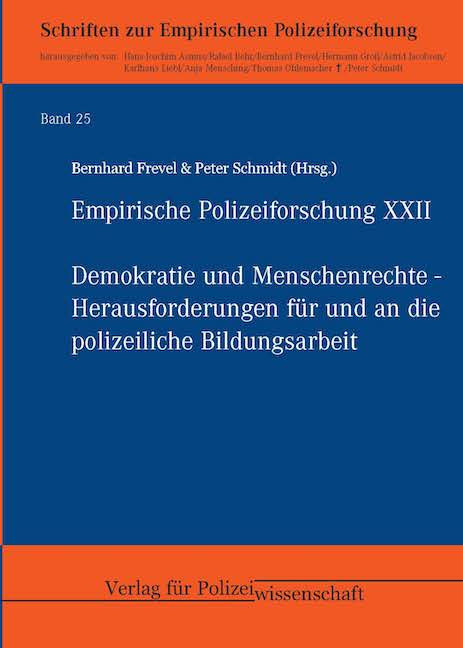Daniela Hunold und Astrid Jacobsen(Hrsg.)
Ordnung schaffen! Konzepte, Strukturen und Praktiken des Polizierens

Inhalt
Inhalt:
Daniela Hunold & Astrid Jacobsen
Einleitung
Rafael Behr
„Polizei-Stehenbleiben“ – Strategien zur Bewerkstelligung von Herrschaft. Ethnographische Erkundungen im Alltag des Gewaltmonopols.
Matthias Weber
Mentale Respräsentationen von Autorität
Luis-Miguel Herrmann
Brennpunkte und Verpolizeilichung – weniger Polizei für ein besseres Sicherheitsgefühl?
Emanuel John
Das Polizieren einer inklusiven sozialen Ordnung: Was bei der Realisierung von Menschenrechten durch die Polizei beachtet werden sollte
Jens Bergmann und Astrid Jacobsen
Zur Ordnung polizeilicher Ungleichheitsproduktion: Empirische Erkenntnisse über die Praxis des (ordnenden) Polizierens und ihrer Risikokonstellationen für Diskriminierung
Kai Seidensticker
(Über- und Unter-)Ordnung in der Polizei. Irritation und Stabilität von Geschlechterverhältnissen in der Postmoderne
Eric Töpfer und Clemens Arzt
Risiken rassistischer Diskriminierung in der polizeilichen Datenverarbeitung
Hermann Groß/Rafael Behr/Nathalie Hirschmann/Daniela Hunold/Astrid Jacobsen/Anja Mensching/ Marschel Schöne (Hrsg.)
Polizei – Hochschule – Ministerium. Festschrift 2.0 für Peter Schmidt

Inhalt
Inhalt:
Groß/Rafael Behr/Nathalie Hirschmann/Daniela Hunold/Astrid Jacobsen/Anja Mensching/Marschel Schöne
Peter Schmidt: Die etwas andere Festschrift oder Festschrift 2.0
Astrid Jacobsen
Mysterium Ministerium. Ein (persönliches) Essay
Anja Mensching
Peters TAKT(ik)
Daniela Hunold
Besonderer Dank – Oder: Peter in Hamburg
Clemens Lorei/Hermann Groß
Polizei & Liebe. Skizzen zu einer Tagung die (noch) nicht stattgefunden hat
Rafael Behr
Vom Glück der Heiterkeit und vom Unglück des Hassens. Wie sich Polizei und Welt verändern (lassen). Eine kleine Hommage auf Peter Schmidt
Marschel Schöne
Oani vun de bekannstesten Maabriggs en Froangfort
Christopher Alt
Büttenrede
Olaf Rohde
Peter Schmidts Gedicht
Bernhard Frevel
Zwischen allen Stühlen? Prakademiker. Fast eine Analyse zu Peters Schmidts Karriere
Cornelia Rotter/Verena Schulze/Philipp Kuschewski
Laudao für Peter Schmidt. Eine Reise in Diensten der Inneren Sicherheit und Wissenschaft
Fred Bauer
Sketch
Martina Liebich-Frels
Lieber Peter,
Joachim Michalik
Das dynamische Miteinander der Polizeiseelsorge und der hessischen Polizei. Staat und Kirche gemeinsam in Sorge um die Menschen. Eine immer neue Perspektive von Innen und Außen
Barbara Görich-Reinel
Zwischen dankbarer Erinnerung und Hoffnung auf Realisierung
Walter Seubert
Berufliche Lebenswege
Werner D’Inka
Peter Schmidt und die Heinrich-Mörtl-Stiftung
Necati Benli
„Früher war es nicht meine Polizei – aber so allmählich wird sie es“.
Von Positionen und Positionierungen im Wandel der Organisationskultur. Ein Essay
Stefan Schütz
Peter Schmidt: Mentor. Kollege. Sportskamerad. Freund
Gerd Thielmann
Wie Peter Schmidt eine lokale Berühmtheit als Entertainer wurde
Gerd Thielmann
In sieben Schritten durch die Weltgeschichte: Wie Friedrich Wilhelm I. dafür sorgte, dass Peter Schmidt Referent für Hochschulwesen wurde
Werner Abram
Für Peter Schmidt zum Ruhestand
Sabine Thurau
Lieber Peter,
Peter Schmidt
Schriftenverzeichnis
Autorinnen und Autoren
Hermann Groß/Nathalie Hirschmann/Daniela Hunold/Astrid Jacobsen/Anja Mensching/Peter Schmidt/Marschel Schöne (Hrsg.)
Kultur. Struktur. Praxis. Reflexionen über Polizei. Festschrift für Rafael Behr

Inhalt
Inhalt:
Hermann Groß/Nathalie Hirschmann/Daniela Hunold/Astrid Jacobsen/ Anja Mensching/Peter Schmidt/Marschel Schöne
Rafael Behr
Anja Mensching
Von einem, der auszog, als Polizeiforscher auf die Polizei und als Polizist auf die Polizeiforschung zu schauen
Udo Behrendes
Fragen an einen früheren Kollegen – Ein Interview mit Rafael Behr – Teil 1
Josef Pfaffenlehner
Das Berufsbild der Polizei im Spannungsfeld zu Ethik und Bildung
Werner Schiewek
Was macht die ‚Guten‘ gut? – Rafael Behrs Anregungen für die Polizeiethik
Clemens Lorei/Kerstin Kocab
Gut Ding will (W-)Eile haben
Marschel Schöne
Von Bullen und Sozialsofties. Das Verhältnis von Polizei und Sozialer Arbeit
Nathalie Hirschmann
Graphic Novel
Eva Groß/Joachim Häfele
Polizei und Wissenschaft im ambivalenten Verhältnis
Antonio Vera
Von der ethnografischen Feldforschung zur explorativen Faktorenanalyse – Methodologische Entwicklungen bei der Erforschung der Organisationskultur der Polizei
Peter Schmidt/Hermann Groß
Hochschule und Polizeibehörde unter einem Dach: Gelungenes Bildungskonstrukt oder Fehlkonstruktion?
Bernhard Frevel
Funktion und Wirkung von Kultur(tätigkeit) in der Polizei – Eine ‚Leerstelle‘ in Rafael Behrs Cop-Culture-Forschung
Thomas Gundlach
Zum Verhältnis von Kriminologie und Kriminalistik oder wer braucht hier eigentlich wen?
Udo Behrendes
Fragen an einen früheren Kollegen – Ein Interview mit Rafael Behr – Teil 2
Nils Zurawski
„Der will doch nur ins Fernsehen“ – Gedanken zur Figur des engagierten Wissenschaftlers und den Abwehrreflexen einer Organisation
Christoph Kopke/Oussama Laabich
Polizeiliches Erfahrungswissen oder vorurteilsgerichtete Ermittlungspraxis? – Zur Debatte um Racial Profiling
Thomas Feltes/Wolfgang Mallach
Risiken und Nebenwirkungen im Polizeialltag: Der Lagebedingte Erstickungstod
Daniela Klimke
„Nur tuntig darfst Du nicht sein“ – LGBTIQ* und Polizei
Hartmut Aden
Die Kontrolle der internationalen Polizeizusammenarbeit und des Streetlevel-Policing – Zwei getrennte Welten
Astrid Jacobsen
Lagebild Behr
Daniela Hunold
Rafael Behr: Klarheit und Erkenntnis
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Hermann Groß/Peter Schmidt (Hrsg.)
Empirische Polizeiforschung XXV: Polizei und Forschung: Stillstand oder Fortschritt?
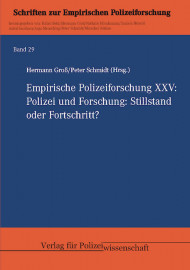
Inhalt
Inhalt:
Hermann Groß/Peter Schmidt
Editorial: Polizei und Forschung: Stillstand oder Fortschritt?
Christiane Howe
Forschung – Kritik – Polizei
Marilena Geugjes/Georgios Terizakis
Feldzugang zur und Rückführung der Forschungsergebnisse in die Polizei: Fortschritt, Stillstand – Rückschritt?
Clemens Lorei/Hermann Groß
Zur Lage der Polizeiforschung an deutschen Polizeihochschulen
Laila Abdul-Rahman/Luise Klaus
Übermäßige polizeiliche Gewaltanwendungen – Situationen, Bewertungen, Aufarbeitung
Jule Fischer/Eva Sevenig
Motivation, Einstellungen und Gewalt im Alltag des Polizeivollzugsdienstes – Ergebnisse der qualitativen Erhebungen der Studie MEGAVO
Christoph Andree/Jochen Wittenberg
Motivation und Einstellungen im Polizeialltag – Quantitative Befunde der bundesweiten MEGAVO-Befragung
Eliane Ettmüller
Der direkte Einsatz gesellschaftswissenschaftlicher Expertise in der Praxis der Hessischen Polizei – Die Eröffnung neuer Forschungsperspektiven?
Bernhard Frevel
Essay: Empirische Polizeiforschung im Rahmen der Forschung für die zivile Sicherheit
Tom Kattenberg/Anne Melzer
Black Box Spezialeinheiten der Polizei – schwieriger Feldzugang aber dringender Forschungsbedarf hinsichtlich der Recruiting-Probleme beim MEK und SEK
Johannes Siegel
Die Struktur des Racial Profiling
Andreas Ruch
Polizeibeauftragte und die Notwendigkeit effektiver Kontrolle der Polizei
Silke Müller/Alexandra Tatar/René Selbach
Poster: Innere Sicherheit & Demokratische Resilienz – INSIDER. Polizeistudie für das Land Rheinland-Pfalz
Silke Müller
Poster: Aktuelle Herausforderungen qualitativer Polizeiforschung. Erfahrungen aus der rheinland-pfälzischen Polizeistudie „INSIDER“
Barbara Bergmann
Poster: Braucht es psychologische Expertise für polizeiliche Risikoanalyse?
Nele Hingmann
Poster: Die Rolle von Social Media und Crowdsourcing für die Polizei -Ein Überblick des Projektes LINKS
Esther Jarchow
Poster: Bewegung im Forschungsgeschäft
Nicole Bartsch
Poster: Interkulturelle Kompetenz in der Landespolizei
Rafael Behr/Hermann Groß/Nathalie Hirschmann/Daniela Hunold/Astrid Jacobsen/Anja Mensching/Peter Schmidt/Marcel Schöne (Hrsg.)
Gemeinwesenbezogene Sicherheitsarbeit Festschrift für Bernhard Frevel

Inhalt
Inhalt:
Rafael Behr/Hermann Groß/Nathalie Hirschmann/Daniela Hunold/Astrid Jacobsen/Anja Mensching/Peter Schmidt/Marcel Schöne
Bernhard Frevel und die empirische Polizeiforschung
Karlhans Liebl
Der „neue“ Arbeitskreis „Empirische Polizeiforschung“ – Entwicklung und Bewertung der Jahre 2006 bis heute
Jonas Grutzpalk
Erstaunliche Begegnung. Ein Schweifreim zum Geburtstag
Hermann Groß/Peter Schmidt
Reform, Reförmchen oder Zeitenwende? Das neue Leitbild der hessischen Polizei
Christoph Spieker
Essay zum Leitbild vom „Freund und Helfer“ im Laufe der Zeit
Marschel Schöne
Geschlecht, Gender und Polizei. Eine Forschungsskizze
Tobias John/Nathalie Hirschmann
Wissenstransfer zwischen den Sphären Sicherheitsforschung und Sicherheitspraxis
Colin Rogers
Evidence-Based Policing in Community Policing: its utility and use by new police recruits in England and Wales
Christiane Howe
Ansätze für Analyse und Handlungsempfehlungen kommunaler Sicherheit in von Migration geprägten Quartieren
Tim Eichler
Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt: Ein Paradigmenwechsel im städtischen Sicherheitsmanagement
Marcus Kober/Katharina Mohring/Jan Lorenz Wilhelm
Kommunale Sicherheitsanalysen: „In die Lage kommen“
Frauke A. Kurbacher
Freiheit und Kritik als Fragen der ‚inneren Sicherheit‘ – oder zur Philosophie des Unvorhersehbaren und der Relevanz politischer Bildung
Felix Bode/Kai Seidensticker
Abstract Police
Clemens Lorei/Kristina Balaneskovic
Unsicherheiten bei der Sicherheit von Einsatzkräften. Ein Essay um, zum und über das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte
Maike Meyer/Daniela Pollich
Die „Angst vor’m bösen Mann“ revisited – Aktuelle Erkenntnisse über das Sicherheitsempfinden
Anja Mensching
Die Polizei als organisationale Produzentin von (Un)Sicherheit
Rafael Behr
Vom reflektierten Praktiker zum fungiblen Vollstrecker: Wenn Cop Culture und autoritäre Dynamiken amalgamieren
Christoph Gusy
Legitimationsfragen im Notfall
Anders Green
Crime prevention, beyond policing. A division of labour and responsibility
Hartmut Aden
Wissenschaftliche Polizeiausbildung – Trends, Defizite und Perspektiven
Christoph Kopke/Philipp Kuschewski
„Politische Bildung und Polizei“: Zwei Projekte im Portrait
Daniela Hunold/Astrid Jacobsen
“Defund the Police“ als Thema der politischen Bildung in der Polizei
Nils Voelzke
Schule im Konzept gemeinwesenbezogener Sicherheitsarbeit – Local Safety and Security Governance aus schulischer Perspektive
Patrick Ernst Sensburg
Die Rolle der Polizei in der Landes- und Bündnisverteidigung
Vanessa Salzmann
Der NSU-Skandal und seine Konsequenzen für die gemeinwesenbezogene Sicherheitsarbeit
Claudia Regler
Parteipolitische Positionen zur Inneren Sicherheit am Beispiel der Maßregel der Sicherungsverwahrung
Klaus Schubert
Das Menschen- und das Weltbild des Pragmatismus: Zeit und Raum in einer dynamischen, demokratie-endogenen politischen Theorie
Bernhard Frevel
Publikationen zur Polizei- und Sicherheitsforschung
Autorinnen und Autoren
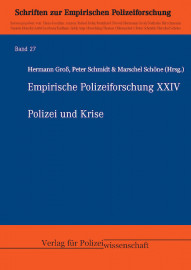
Krisen sind auch für das soziale System Polizei notwendiger Impuls für Lernprozesse und die (Weiter)Entwicklung von strategischen, strukturellen und personellen Potenzialen. Die Tagung „Polizei und Krise“ setzte sich im Kontext dieser Lernerfahrungen und Transformationen in 9 Vorträgen von 20 Referent:innen und den anschließenden Diskussionsrunden mit den polizeilichen Kategorisierungen der Ursachen und Bewältigungen von Krisen auseinander, mit der Koevolution von Polizei, Recht und Polizeikritik, thematisierte die Polizei im Spannungsfeld von Flucht und Migration, den Zusammenhang von Arbeitsbelastung und Krisendynamik und fokussiert im Weiteren auf konkrete Phänomene wie Homosexualität und Polizei, sexualisierte Grenzverletzungen innerhalb der Polizei sowie die Spezifik der Pandemieleugner:innenbewegung als polizeiliche Herausforderung.
Inhalt
Inhalt:
Editorial: Polizei und Krise
Hermann Groß, Peter Schmidt, Marschel Schöne
Die Konstruktion des polizeilichen Gegenübers – Kategorisierungen in der polizeilichen Arbeitspraxis
Berit Merla
Die Polizei in Zeiten der „Flüchtlingskrise“: Lokale Spezifika im Umgang mit Flucht
Leonie Jantzer, Svenja Keitzel, Georgios Terizakis
Krise – Krankheit – Polizei
Josephine Jellen
Aus der Geschichte gelernt? Die „Flüchtlingskrise“, Lerneffekte und Chancen für die Polizei
Jana-Andrea Frommer, Malte Schönefeld, Yannic Schulte, Patricia M. Schütte, Günther Epple, Frank Fiedrich
Sexualität und Macht in der Polizei – Gründe für die Krisen-Inkompetenz bei (sexuellen) Grenzüberschreitungen
Christian Barthel, Claudia Puglisi
Ich krieg die Krise! Wie öffentliche Krisenerfahrungen in die Polizeiausbildung hineinwirken und sich kumulativ auf das Curriculum auswirken
Jens Bergmann, Stephanos Anastasiadis, Jonas Grutzpalk
Zu den Autor:innen
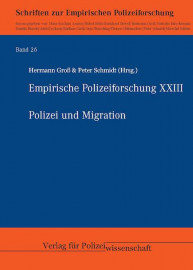
Inhalt
Inhalt:
Hermann Groß/Peter Schmidt
Editorial: Polizei und Migration
Christian Semler
Polizei und Migration – im Kontext mit den Begriffen Recht und Gerechtigkeit, vor dem Hintergrund ständiger globaler, gesellschafts- und sozialpolitischer Veränderungen – eine philosophische Betrachtung
Linda Jakubowicz
Migrationsforschung im Bundesministerium für Inneres – mehr als die Sicherheitsperspektive
Daniel Church/Christoph Birkel
Viktimisierungsrisiko und Anzeigeverhalten von Migrantinnen und Migranten
Bernhard Frevel/Christiane Howe
Vulnerabilität in migrantisch geprägten Quartieren – Forschungsprojekt „Migration und Sicherheit in der Stadt – migsst“
Hartmut Aden/Alexander Bosch/Jan Fährmann
Kontrollieren – aber wie? Können technische Innovationen die Akzeptanz für polizeiliche Personenkontrollen verbessern?
Carsten Dübbers
Umgang der Kölner Polizei mit den Silvesterereignissen
Alida Meier
Racial Profiling – praktiziert, empfunden oder gefordert?
Perspektiven der Polizei
Annelie Molapisi/Rafael Behr
Polizeibeamt*innen mit Migrationsgeschichte in der Phase der beruflichen Sozialisation – aktuelle Befunde
Eva Brauer/Tamara Dangelmaier/Daniela Hunold
Die diskursive Konstruktion von Clankriminalität
Thomas Müller
Die „gefährliche und volatile“ Rolle des Selbstwertgefühles für Helfer*innen im Falle von massiven Migrationsbewegungen
Peter Faesel
Jetzt mal Klartext … Was halten Polizei und Fremde eigentlich wirklich voneinander? Und hat das was mit Kultur zu tun?
Eine empirische Untersuchung zu impliziten Einstellungsmustern von Migrant*innen und Polizeibeamt*innen
Daniela Gutschmidt/Antonio Vera
Cop Culture und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Polizei: eine empirische Analyse
Jana-Andrea Frommer/Malte Schönefeld/Patricia M. Schütte/Andreas Werner/Günther Epple/Frank Fiedrich
„Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler“ – Ansatzpunkte für ein Lernen der Polizei aus den Flüchtlingsbewegungen 2015/2016
Lars Wagner/Dieter Wehe
Die Einrichtung des Fachgebietes Internationale Polizeiliche Beziehungen an der Deutschen Hochschule der Polizei – Eine Investition in Gegenwart und Zukunft
Wulf Köpke/Beate Hahn/André Schulz
Transkulturelles Wissen – Die Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts für die Polizei!
1995 – 2019: Fast ein Vierteljahrhundert erfolgreiches Training in interkultureller Kompetenz bei der Polizei Hamburg!
Josephine Jellen
Entgrenzte Arbeit in einer entgrenzten Welt? – Migrationsspezifische Herausforderungen polizeilicher Arbeit
Sabine Nowak/Nina Müller
Bürger-Polizei-Beziehungen in ethnisch divers strukturierten Stadtvierteln
Sabrina Ellebrecht/Laura Wisser
Spieglein Spieglein an der Wand, wer ist Polizist in diesem Land. Eignung für den Polizeidienst in Deutschland und die Frage der Repräsentation
Alexandra Graevskaia/Benedikt Müller/Martin Brussig/Anja Weiß
Personalpolitik und Diversity-Management in der Polizei
Bernhard Frevel & Peter Schmidt (Hrsg.)
Empirische Polizeiforschung XXII Demokratie und Menschenrechte Herausforderungen für und an die polizeiliche Bildungsarbeit
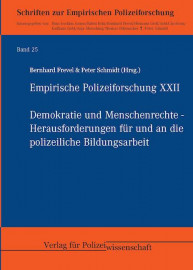
Inhalt
Inhalt:
Editorial: Demokratie und Menschenrechte – Herausforderungen an und für die polizeiliche Bildungsarbeit
Bernhard Frevel
Grundlagen und Orientierungen
Politische Bildung und Polizei – Ein Werkstattbericht zum gleichnamigen Forschungs- und Entwicklungsprojekt
Bernhard Frevel
Die Friedens- und Konfliktforschung als Grundlage einer bürgerorientierten und friedensstiftenden Handlungskompetenz der Polizei
Norbert Kueß
Kritisches Denken und professionelle Polizeiarbeit – Gedanken zur Weiterentwicklung der politischen Bildung in der Polizei
Jochen Christe-Zeyse
Themen und Anwendungsbereiche
Wirkungsvolle Menschenrechtsbildung in der Polizei. Realität oder Illusion mit Feigenblattcharakter?
Günter Schicht
Freiheitsentziehung – Werden die Menschenrechte mit den Effekten abgegeben?
Christina Hof
Polizei und Konzentrationslager – Studientage für angehende Polizist/innen
Julius Scharnetzky
Mehr gelernt als geplant? Versteckte Lehrpläne im Einsatztraining
Mario Staller, Swen Körner, Valentina Heil und André Kecke
Betzavta (Miteinander) – Mehr als eine Demokratie. Einbindung eines Demokratielernprogramms in die polizeiliche Aus- und Fortbildung
Peter Faesel
Didaktische Herausforderungen
Menschenrechtsbildung und Toleranz gegenüber Ambiguität Zur Kooperation der HWR Berlin mit Amnesty International
Hartmut Aden und Alexander Bosch
Menschenrechte als Herausforderung für die Fachgruppe Ethik an der FHöV NRW
Michael Borowski
Politische Bildung und Emotionen
Lena Lehmann