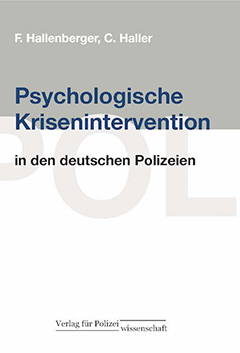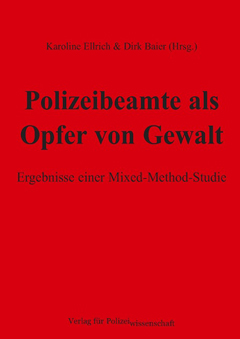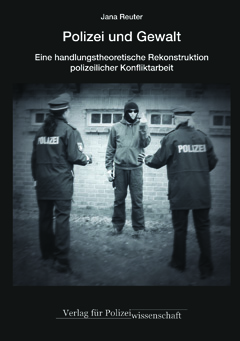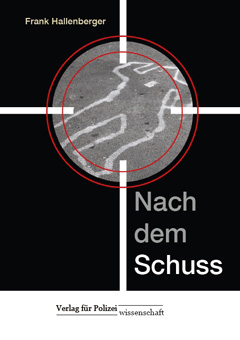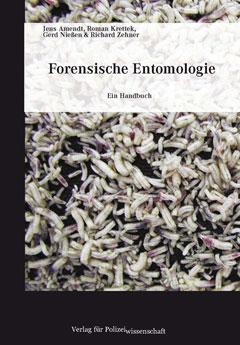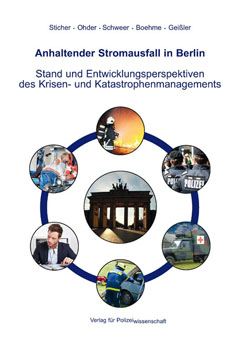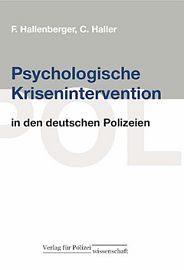
Polizeibeamte sind normale Menschen mit einem außergewöhnlichen Beruf. Man mag fragen, was ist an diesem Beruf so außergewöhnlich? In unserem Sinne möchten wir dies dahingehend verstanden wissen, dass Polizeibeamten das Gewaltmonopol des Staates praktisch ausüben. Allein hierdurch besteht die Gefahr, dass sie belastet oder sogar traumatisiert werden. Durch diese Arbeit sind die Polizisten aber auch immer wieder Zeugen und Ziel von Gewalt und können hierdurch Entsetzen, Hilflosigkeit oder Angst erfahren, Emotionen, die konstituierende Merkmale für posttraumatische Reaktionen darstellen.
Seit Mitte der 1990er Jahren wird Betroffenen durch Psychosoziale Fachkräfte der Polizei und weitergebildeten Polizeibeamten Unterstützung angeboten, wenn die Gefahr besteht, dass sie über die Maßen belastet worden sein könnten. Ausgehend von der Synopse von Marx aus dem Jahr 1999 haben wir den derzeitigen Stand der Krisenintervention in den deutschen Polizeien des Bundes und der Länder erfasst und stellen ihn hiermit den in diesem Themenbereich Tätigen zur Verfügung.
Inhalt
Inhalt:
Zusammenfassung
Einleitung
Stress und Trauma
Psychologische Krisenintervention
Kriseninterventionskräfte
Critical Incident Stress Management
Psychologische Krisenintervention
Voraussetzungen der Helfer
Allgemeine Aus- und Weiterbildungsinhalte
Spezifische Aus- und Weiterbildungsbildungsinhalte
Bundesvereinigung für Stressbearbeitung - SbE
Betreuungskonzepte nach besonders belastenden Ereignissen
Qualitätsstandards
Ist-Stand der Kriseninterventionin den Ländern und im Bund
Methode
Einzelergebnisse
Vergleichende Ergebnisdarstellung und Diskussion
Regelnde, verbindliche Grundlage der Krisenintervention
Anzahl der Mitarbeiter in der Krisenintervention
Aufgabenbereiche der Helfer
Auswahl potenzieller Helfer
Schwerpunkte in der Aus- und Fortbildung
Methodische Grundlagen der krisentinterventorischen Tätigkeit
Struktur der Teams
Aufarbeitung der Belastung der Helfenden / Supervision
Erreichbarkeit der Helfenden
Einsatzbereiche der Teams
öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der Hilfsangebote
Fazit und Ausblick
Literatur
Anhang – Interviewleitfaden
Karoline Ellrich & Dirk Baier (Hrsg.)
Polizeibeamte als Opfer von Gewalt Ergebnisse einer Mixed-Method-Studie
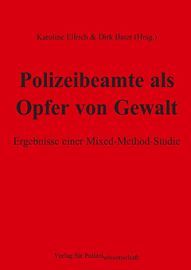
Inhalt
Inhalt:
Dirk Baier, Karoline Ellrich
Vorstellung des Forschungsprojekts und der kriminalstatistischen Ausgangslage
Dirk Baier, Karoline Ellrich
Vertrauen in die Polizei im Spiegel verschiedener Befragungsstudien
Stefan Prasse, Hartmut Pfeiffer
Gewalt gegen Polizeibeamte in Niedersachsen. Analyse der Strafverfahren nach übergriffen auf Polizeibeamte mit schweren Folgen der Jahre 2005 – 2009
Karoline Ellrich, Dirk Baier
Gewalt gegen Polizeibeamte aus Niedersachsen. Ein Vergleich der Ergebnisse der Online-Befragung und der Strafverfahrensanalyse
Karoline Ellrich, Dirk Baier
Wer wird nach einem Gewaltübergriff dienstunfähig, wer nicht?
Eine Analyse von Einflussfaktoren auf die Dienstunfähigkeit
Karoline Ellrich, Dirk Baier
Posttraumatische Belastungsreaktionen bei Polizeibeamten nach Gewaltübergriffen. Eine Untersuchung zu polizeispezifischen Einflussfaktoren
Bettina Zietlow
Die Bewältigung schwerer Gewaltopfererfahrungen im Polizeiberuf. Befunde qualitativer Interviews
Andreas Belger, Matthias Wied, Johannes Schütze, Janine Quenstedt, Frank Wimmel, Rüdiger Fink, Andrea Hartmann
Ergebnisse der Auswertungen von Freitextangaben viktimisierter Polizeibeamter
Ordnungsstörungen
Demonstrationen
Verkehrsüberwachungen
Fußballveranstaltungen
Familienstreitigkeiten/Gewalt in engen sozialen Beziehungen
Einsätze im Rahmen von Streitigkeiten, Körperverletzungsdelikten, Schlägereien
Polizeiliche Festnahme/Ingewahrsamnahme
Karoline Ellrich, Dirk Baier, Bettina Zietlow
Zusammenfassung und zukünftige Forschungsideen
Jana Reuter
„Polizei und Gewalt“ Eine handlungstheoretische Rekonstruktion polizeilicher Konfliktarbeit
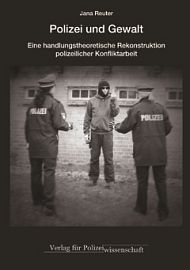
Die Polizei als Inhaberin des „Gewaltmonopols des Staates“ ist durch Gesetz zur Anwendung von unmittelbarem Zwang legitimiert. Diesem Gewalthandeln des Staates steht die kriminalisierte Gewalt von Privatpersonen gegenüber. Durch diese Dichotomie wird aus Sicht der Verfasserin der Entstehungskontext von Gewalt zwischen der Polizei und dem Bürger vernebelt. Daher wird die Eskalation und die Deeskalation von Gewalt zwischen Polizeibeamten und ihrem Klientel in der vorliegenden Studie als Interaktionszusammenhang verstanden.
Weil die Forscherin selbst auch Polizeibeamtin des operativen Einzeldienstes ist, nimmt sie eine Doppelrolle ein und forscht aus der Polizeipraxis heraus mit einem hohen Maß an Selbstreflexivität über ihre eigene Berufsrolle. In der vorliegenden explorativen Studie wird untersucht, welche Rolle die Einstellungen, die Gestik und Mimik, die Kommunikationsinhalte und das Einsatzverhalten der Polizeibeamten sowie der von ihnen nach außen getragenen Symbole bei der Entstehung von Gewalt spielen. Abgerundet wird die Arbeit mit fundierten Präventionsvorschlägen und einem Exkurs zur Erklärung der These des Anstiegs von Gewalt gegenüber Polizeibeamten.
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
2. Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes
2.1 Forschungsstand „Gewalt gegen Polizei“
2.1.1 Untersuchung von Fritz Manglkammer 1938
2.1.2 Studie von Jürgen Martin 1951
2.1.3 Untersuchung von Siegfried Borchardt 1955
2.1.4 Untersuchung von Ralf Stührmann 1965
2.1.5 Studie von Klaus Sessar 1980
2.1.6 Studien von Joachim Jäger 1987, 1988, 1994
2.1.7 Studie von Ekkehard Falk 2000
2.1.8 Studie des KFN 2003
2.1.9 Studie des KFN 2010
2.1.10 Kriminologische Untersuchung zur Gewalt gegen Polizeibeamte aus Tätersicht von Rita Steffes-enn 2012
2.1.11 Studie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW 2011/2012
2.1.12 Projekt der Polizei in Hessen
2.1.13 Projekt des KFN „Gewalt gegen Polizeibeamte und –beamtinnen aus dem Einsatz- und Streifendienst
2.2 Forschungsstand „Gewalt von Polizei“
2.2.1 Darstellung der Zahlen von PKS und StVSt zu rechtswidrigen Gewaltdelikten durch die Polizei
2.2.2 „Polizisten vor Gericht“ Tobias Singelnstein
2.2.3 Bericht von Amnesty International „Täter unbekannt“
2.3 Folgen und Auswirkungen der bisherigen Studien
2.4 Rechtliche Grundlagen
2.5 Theoretischer Rahmen
2.5.1 Sozialbehaviorismus nach Georg Herbert Mead
2.5.2 Der Symbolische Interaktionismus nach Herbert Blumer
2.5.3 Ertrag der Theorien für die vorliegende Forschungsarbeit
2.6 Begriffsbestimmung
2.6.1 Definition des Gewaltbegriffs im Rahmen dieser Arbeit
2.6.2 Definition des Begriffs „Polizei“
2.7 Forschungsfrage
3. Forschungsdesign
3.1 Auswahl des Beobachtungszeitraumes
3.2 Auswahl und Beschreibung der Dienststelle und Streifenteams
3.3 Besonderheiten und Störfaktoren
4. Methodische Umsetzung
4.1 Forschungszugang
4.2 Durchführung der teilnehmenden Beobachtung
4.3.1 „Hier herrscht Darwinismus“
4.3.2 „Deeskalation können wir auch“
4.3.3 „Mit Gequatsche zum Erfolg“
4.3.4 „Zeigen, wer hier der Herr im Ring ist!“
4.3.5 „Einen kühlen Kopf bewahren“
4.3.6 „Jeder Mensch ist unterschiedlich und daher ist auch jede Konfliktsituation eine andere!“
4.3.7 „So´n bisschen sind wir eben auch Sozialarbeiter!“
5. Ergebnisdarstellung
5.1 überblick über die Arbeitsergebnisse
5.2 Vergleich mit den Ergebnissen bisher bekannter Studien
5.3 Reflexion der Methode
5.4 Reflexion der Beobachtertätigkeit
5.5 Analyse und Bewertung der Untersuchungsergebnisse
5.5.1 Einstellungen und Handlungen
5.5.2 Kommunikation
5.5.4 Beobachtetes Einsatzverhalten
5.6 Gewalt begünstigende und Gewalt vermeidende Faktoren
5.7 Hypothesenbildung
6. Diskussion der Untersuchungsergebnisse
6.1 Fazit
6.2 Folgen für den Präventionsbereich
6.3 Weitergehende Empfehlungen
6.4 Exkurs zur Erklärung der These des Anstiegs von Gewalt gegenüber Polizeibeamten
Literaturverzeichnis
Sandra Hahn & Klaus Kraimer
Krisenkommunikation Zur Tätereinschätzung bei Bedrohungs- und Geisellagen Eine grenzüberschreitende und interdisziplinäre fallrekonstruktive Studie zum polizeilichen Handeln

Die Krise der Bewältigung von Bedrohungs- und Geisellagen fordert den beteiligten Polizeibeamten eine Lagebeurteilung ab, die rasch und zielorientiert auf Wesentliches zu reduzieren ist. Vor allem ist eine gültige Einschätzung zum Täter zwingend erforderlich, um in der aktuellen Situation eine erste Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu erzeugen.
Innerhalb dieses Buches, das ein Resultat einer dreijährigen internationalen und interdisziplinären Projektarbeit darstellt, wird das polizeiliche Handeln in derartigen Krisensituationen aus sozialwissenschaftlicher, psychologischer und polizeilicher Perspektive heraus rekonstruiert. Um das Phänomen der Geisel-/Bedrohungslage zu ergründen, wurden zwei Echtlagen aus verschiedenen Ländern ausgewählt. Daran werden exemplarisch methodische Schritte im Rahmen einer hermeneutisch orientierten Fallrekonstruktion aufgezeigt.
Ein solches Vorgehen und die damit einhergehende Typenbildung kann dem Ermittlungsbeamten helfen, einen fundierten und auf wissenschaftlichen Methoden beruhenden Zugang innerhalb einer Lagebewältigung kennen zu lernen. Das Ziel ist die Erzeugung professioneller Kompetenzen durch Systematisierung und Zusammenführung interdisziplinärer Wissensbestände (z.B. aus der Sozial-, Kommunikations-, und Polizeiwissenschaft sowie der Psychologie).
Inhalt
INHALT
Grußwort der Ministerpräsidentin
Vorwort
Einführende Problemskizze – Fragestellung und Problematisierung
des Forschungsgegenstandes
Theoretischer Teil
1. Grundlagen der Kommunikation im polizeilichen Kontext
1.1 Krise und Routine – Zur stellvertretenden Krisenbewältigung im Spannungsfeld zwischen Traumatischer Krise und Entscheidungskrise
1.2 Krisenkommunikation
2. Handeln in besonderen Lagen – Eine interdisziplinäre Perspektive
2.1 Handlungs- und Kommunikationsmacht
2.2 Verhandeln als Handlung. Von der Geisellage zur Verhandlungs- gruppe der Polizei – Eine historische Betrachtung
2.3 Zum professionellen Handeln in Extremsituationen – Verhandlung als notwendiges Element der Krisenbewältigung
3. Darstellung der polizeilichen Maßnahmen bei Bedrohungs- und Geisellagen in Deutschland und Luxemburg
3.1 Polizeiliche Aufgabenbereiche
3.2 Geisellage, Bedrohungslage, Entführung – eine Abgrenzung aus polizeilicher Sichtweise
3.3 Begriff der Einsatzlage
3.4 Polizeitaktische Maßnahmen bei Geisel- und Bedrohungslagen in Deutschland und Luxemburg
3.4.1 Polizeitaktische Maßnahmen in Deutschland
3.4.2 Polizeitaktische Maßnahmen in Luxemburg
3.4.3 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeibehörden in der Grossregion ›Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz und Wallonie‹
4. Zur Typenbildung und Täterprofilerstellung
4.1 Empirisch begründete Typenbildung
4.2 Täterprofilerstellung und Typenbildung innerhalb von Geisellagen
4.3 Täter- und Opfereinschätzung aus polizeilicher Perspektive
5. Zwischenfazit – Bilanzierung vorliegender Erkenntnisse
Empirischer Teil
6. Zur Methodologie und Methodik der qualitativen Studie
6.1 Verlauf der Untersuchung
6.2 Datenschutz
6.3 Zum Forschungsdesign – Datenerhebungs- und Auswertungs- verfahren
6.3.1 Transkription
6.3.2 Die Methode der Fallrekonstruktion – Zur Logik der Auswertung
7. Analyse des Datenmaterials
7.1 Analyse des nationalen Falls
7.1.1 Ereignisschilderung des nationalen Falles
7.1.2 Analyse der objektiven Daten
7.1.3 Analyse der Verhandlungsgespräche
7.2 Analyse des internationalen Falls
7.2.1 Ereignisschilderung des internationalen Falles
7.2.2 Analyse der objektive Daten
7.2.3 Analyse der Verhandlungsgespräche
8. Erkenntnisgewinnung aus den einzelfallanalytischen Rekonstruktionen der Bedrohungs-/Geisellagen – Zur Tätertypenbildung aus den Fällen
Bilanzierender Teil
9. Fazit und Perspektiven – Anregungen für einen Orientierungsrahmen für den Bereich der polizeilichen Analysetätigkeit
10. Die Täter-/Opfereinschätzung als wesentlicher Baustein der polizeilichen Lagebewältigung – Fazit und Perspektiven im Kontext der Projektarbeit
Literatur
Anhang
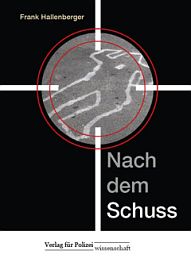
Frank Hallenberger, Dr. rer. nat., Diplompsychologe, Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Fachbereich Polizei in Rheinland-Pfalz, Polizeipsychologe, Klinischer Hypnosetherapeut, Aufbau und Leitung des Kriseninterventionsteams der Polizei Rheinland-Pfalz, zusammen mit dem Polizeiseelsorger Hartmut von Ehr Leitung der Post Shooting-Seminare.
Wohl kaum ein anderes Ereignis wird in den Medien verzerrter dargestellt als der polizeiliche Schusswaffengebrauch gegen Menschen. Zum einen hinsichtlich der Häufigkeit zum anderen bezüglich der Auswirkungen auf den Schützen. Diese beiden Aspekte stehen im diametralen Gegensatz zur Realität: Der polizeiliche Schusswaffengebrauch gegen Menschen ist einerseits eher seltenes Ereignis, hat jedoch häufig starke Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten der Schützen. Um diesem Bild entgegenzuwirken, Fachleuten zu diesem Themenbereich weitere Informationen zu vermitteln und – nicht zuletzt – um Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, werden in diesem Buch die internationalen wissenschaftlichen Erkenntnisse in Verbindung mit den Erfahrungen des Autors mit Polizisten, die auf Menschen geschossen haben, dargestellt. Praxisnahe Abrundungen erfahren diese Ausführungen durch Beispiele von Betroffenen.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Einleitung
Bedeutung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs
Der Beginn der „Post-shooting-Seminare“
Die „Post-shooting-Gruppe“
– Die Stichprobe
– Die Vorgehensweise (Methode)
– Die Ereignisse
– Die Beschwerden aufgrund der Ereignisse
– Folgen des Schusswaffengebrauchs
Erkenntnisse zu den Folgen des polizeilichen Schusswaffengebrauchs
Hilfen und Schädigungen nach den Ereignissen
– Aufzählung der Seminare von 1996 bis 2011
– Der Ablauf eines Seminars:
– Bewertung der Seminare
– Welche Effekte hatten die Seminare?
Erkenntnisse aus der/den „Post-shooting-Gruppe/Seminaren“
Fazit und Ausblick
Literatur
Anhang
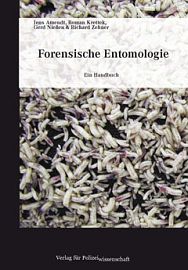
über die Autoren:
Dr. Jens Amendt (47), Studium der Biologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, Promotion in Entomologie am Naturkundemuseum und Forschungsinstitut Senckenberg (Frankfurt am Main). Seit 1997 Forschungsarbeiten und Erstellung von Gutachten auf dem Gebiet der Forensischen Entomologie, seit 2000 Leiter des Bereichs Forensische Entomologie am Zentrum der Rechtsmedizin (Frankfurt am Main).
Dipl.-Biol. Roman Krettek (49) Studium der Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, neben seiner entomologischen Tätigkeit Arbeiten auf dem Gebiet der Fischökologie und Mykologie. Seit 1997 Forschung und Gutachtenerstellung auf dem Gebiet der Forensischen Entomologie. Nach Projekten am Forschungsinstitut Senckenberg und der Universität Kassel nun Sachbearbeiter in der Naturschutzbehörde des Landkreises Kassel.
Rechtsanwalt Gerd Nießen (34) Studium der Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, seit 2002 freier Mitarbeiter im Bereich Forensische Entomologie am Institut für Rechtsmedizin (Frankfurt am Main) mit Schwerpunkt Kriminalistik und Kriminologie, Straf- und Strafprozessrecht.
Dr. Richard Zehner (48) Studium der Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Bereichsleiter DNA-Analytik am Institut der Rechtsmedizin Frankfurt am Main. Sachverständiger für forensische Genetik (Erstellung von Spuren- und Abstammungsgutachten). Seit 2000 Mitarbeiter im Bereich Forensische Entomologie. Forschungstätigkeiten zu molekulargenetischen Methoden der Identifizierung und der Altersbestimmung von nekrophagen Insekten.
Homepage des Institutes für Rechtsmedizin
Inhalt
Inhalt:
A Zum Gebrauch dieses Handbuchs
1. Einleitung
1.1 Forensische Entomologie – Was ist das?
1.2 Es war einmal eine Made: Eine kurze Geschichte der Forensischen Entomologie
2. Insekten auf Leichen: Biologie und ökologie
2.1 Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt – die Verwesung des menschlichen Leichnams
2.2 Vom Wettlauf mit der Zeit – Insektenbesiedlung eines Leichnams
2.2.1 Insekten – Plage oder wichtiger Bestandteil unseres ökosystems?
2.2.2 Vom Ei bis zum erwachsenen Tier – der Insekten-Entwicklungszyklus
2.2.3 Insekten auf Leichen
2.2.3.1 Fliegen (Diptera)
2.2.3.2 Käfer (Coleoptera)
2.2.3.3 Andere Insekten und Gliedertiere
3. „Crime time“ – Die Fallszenarien
3.1 Fall 1 – Leichenfund in einem Wald
3.2 Fall 2 – Wohnungsleiche
4. Haltet sie! Die Asservierung insektenkundlicher Spuren
4.1 Ein Leitfaden
4.2 Fall 1 – Asservierung
4.3 Fall 2 – Asservierung
5. Die forensische Bedeutung insektenkundlicher Spuren
5.1 Leichenliegezeitberechnung
5.2 Identifizierung nekrophager Insekten
5.3 Entomotoxikologie
5.4 Isolierung und Typisierung menschlicher DNA aus Maden
5.5 Vernachlässigung pflegebedürftiger Personen
5.6 Postmortale Artefakte durch Insektenfrass
6. Die Bewertung und Interpretation insektenkundlicher Spuren
6.1 1+1 = 2 – oder doch 3? über die Aussagekraft entomologischer Befunde
6.2 Fall 1 – gutachterliche Bewertung
6.3 Fall 2 – gutachterliche Bewertung
7. Juristische Relevanz der Forensischen Entomologie
8. Forensische Entomologie – ein Ausblick
9. Fallbeispiele
B Verwendete und weiterführende Literatur
C Anhang und Bildtafeln
Birgitta Sticher, Claudius Ohder, Benedikt Schweer, Karl Boehme, Sarah Geißler
Anhaltender Stromausfall in Berlin Stand und Entwicklungsperspektiven des Krisen- und Katastrophenmanagements
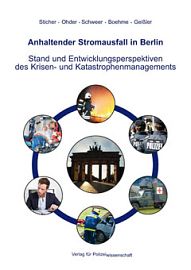
Was passiert bei einem sechstägigen Stromausfall in der Millionenstadt Berlin? Welche Behörden und Organisationen sind für die Bewältigung eines derartig katastrophalen Ereignisses zuständig? Wie funktioniert die Zusammenarbeit der Akteure. Welche Probleme müssen sie bewältigen?
Wissenschaftler der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin haben sich im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts „TankNotStrom“ mit diesen Fragen beschäftigt.
Die Studie skizziert die verheerenden Auswirkungen eines anhaltenden Stromausfalles in Berlin. Sie geht jedoch über das Szenario hinaus und nimmt die zuständigen staatlichen und halb-staatlichen Akteure in den Blick. Besonderes Augenmerk gilt den Kooperationsstrukturen sowie den zwangsläufigen Veränderungen des Managements beim übergang von der Krise zur Katastrophe.
An den Problemen ansetzend, die in Berlin – aber auch in anderen Städten -bei langanhaltendem Stromausfall auftreten würden, gelangt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Bewältigung eines solchen Szenarios änderungen beim Krisen- und Katastrophenmanagement verlangt. Hierbei steht vor allem eine Erkenntnis im Zentrum: Die Bevölkerung muss anders als bisher als aktiver Partner in das Krisen- und Katastrophenmanagement einbezogen werden. Dies gilt nicht nur für Berlin.
Inhalt
Inhalt
1 Vorwort
2 Das Szenario länger anhaltender Stromausfall in Berlin als Ausgangspunkt
2.1 Infrastruktursektoren
2.2 Resümee
3 Vom Krisen- zum Katastrophenmanagement
4 Rechtliche Grundlagen des Katastrophenschutzes
4.1 Bundesgesetzgebung
4.2 Ländergesetzgebung
5 Die Berliner Akteure des Krisen- und Katastrophenmanagements
5.1 Die Berliner Verwaltung
5.2 Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport
5.3 Die Berliner Bezirke
5.4 Die Berliner Feuerwehr
5.5 Die Berliner Polizei
5.6 Die Hilfsorganisationen
6 Weitere Akteure des Krisen- und Katastrophenmanagements
6.1 Das Technische Hilfswerk
6.2 Die Bundespolizei
6.3 Die Bundeswehr
6.4 Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
6.5 Die Unterstützung durch andere Länder
7 Die Organisationsstrukturen für die Zusammenarbeit der Akteure
7.1 Die Zusammenarbeit in der Gemeinsamen Einsatzleitung
7.2 Arbeit in Krisenstäben
7.3 Die Zentrale Einsatzleitung
7.4 Zusammenfassung
8 Prozess des (staatlichen) Krisen- und Katastrophenmanagements in Berlin
8.1 Prozessbeschreibung
8.2 Beginn (Zeitpunkt t0)
8.3 Katastrophenalarm (Zeitpunkt t1)
8.4 Wiederherstellung der Stromversorgung (Zeitpunkt t2)
8.5 Aufhebung des Katastrophenalarms (Zeitpunkt t3)
8.6 Prozess-Schaubild
9 Entwicklungsperspektiven für das Krisen- und Katastrophenmanagement
9.1 Stromausfall: eine stresstheoretische Betrachtung
9.2 Vulnerabilitätstopographie in Berlin
9.3 Erhebung der Ressourcen der Bevölkerung vor der Katastrophe
9.4 Information der und Kommunikation mit der Bevölkerung
9.5 Einbindung der Bevölkerung in das Krisen- und Katastrophenmanagement
9.6 Einbeziehung der Bevölkerung vor der Krise
9.7 Die Kommunikation der Akteure
9.8 Das neue System „TankNotStrom“
10 Ableitung von Konsequenzen für das Krisen- und Katastrophenmanagement
10.1 Konkrete Handlungsempfehlungen
10.2 Weitergehende Empfehlungen
10.3 Forschungsperspektiven
I. Projektdaten
II. Literatur- und Quellenverzeichnis
III. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
IV. Abkürzungsverzeichnis
Rita Steffes-enn
Polizisten im Visier Eine kriminologische Untersuchung zur Gewalt gegen Polizeibeamte aus Tätersicht

Das im Buch präsentierte kriminologische Forschungsprojekt befasst sich mit der Sichtweise von Mehrfachgewalttätern, die auch Gewalt gegen Polizeibeamte angewandt haben. Geleitet von der langjährigen Erfahrung der Autorin in der Täterarbeit, dass Verhaltensweisen von Tätern, selbst wenn sie befremdlich anmuten, dennoch sozialen Regeln folgen, wurde der Frage nachgegangen, welchen Sinngehalt Gewalt gegen Polizeibeamte aus der Täterperspektive hat. Abschließend werden Schlussfolgerungen für die Kriminalpolitik, die Prävention und den unmittelbaren face-to-face-Kontakt gezogen. Denn die Angriffe der hier untersuchten Täter erfolgten keinesfalls aus dem Nichts heraus, selbst wenn im Urteil „ohne rechtfertigenden Grund“ oder „plötzlich und unerwartet“ zu lesen ist.
Die untersuchten Gewalthandlungen reichen von Schubsen/Stoßen über Treten und Schlagen bis hin zum Drohen mit einer Waffe und dem Werfen von Brandsätzen gegen eine Polizeidienststelle.
Inhalt
Gliederung
Abkürzungs- und Bedeutungsverzeichnis
Transkriptionsregeln der qualitativen Interviews
Geleitwort von Rafael Behr
1. Einleitung
2. überblick zum Forschungsstand in Deutschland
2.1 Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (1985 - 2000)
2.2 Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (2005 - 2009)
2.3 Zusammenfassung täterbezogener Erkenntnisse
2.4 Kritische Anmerkungen zur phänomenologisch relevanten Datenlage
3. Theoretische Vorüberlegungen zum Forschungsprojekt
3.1 Gewaltbegriff
3.2 Ausgewählte kriminologische Erklärungsansätze
3.2.1 Mikrokriminologische Ebene: Neutralisierungstheorie
3.2.2 Makrokriminologische Ebene: Anomietheorie
4. Zur Forschungsfrage
5. Die Untersuchungsmethode
6. Zur Durchführung der Erhebung
6.1 Das Erhebungsinstrument
6.2 Die Stichprobe
6.3 Die Interviewerin
6.4 Zur Auswertungsstrategie
6.5 Anmerkungen zur praktischen Durchführung
6.6 Hinweise zur Aussagekraft der Forschungsergebnisse
7. Zusammenfassung der erhobenen quantitativen Daten
8. Auswertung der qualitativen Interviewdaten
8.1 Einstellungen zu Gewalt und Polizei
8.1.1 Neutralisierungstechniken
8.1.2 Interviewauswertung: Gewalt, Normakzeptanz und Neutralisierungen
8.2 Interaktion und die Soziologie des Körpers
8.2.1 Der Körper als ‚Storyteller‘
8.2.2 Männlichkeit, Macht und Herrschaft
8.2.3 Interviewauswertung: Gewalt, Körperrepräsentation und Männlichkeit
8.3 Das Konzept der Salutogenese
8.3.1 Kohärenzgefühl als Kernstück der Salutogenese
8.3.2 Interviewauswertung: Gewalt und Salutogenese
8.4 Demütigung und Unterwerfung
8.4.1 Konflikteskalation
8.4.2 Interviewauswertung: Gewalt, Demütigung und Unterwerfung
8.5 Perspektivenwechsel
8.5.1 Alternativen
8.5.2 Interviewauswertung: Gewaltprävention in face-to-face-Kontakten
9. Resümee
9.1 Kriminologische Mikroebene: Der face-to-face-Kontakt
9.2 Kriminologische Makroebene: Kriminalpolitische Bedeutung oder vom Nutzen der Gewalt gegen Polizeikräfte
9.3 Forschungsausblick
9.4 Abschließende Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Online-Quellen
Zur Autorin