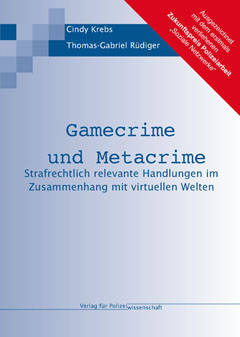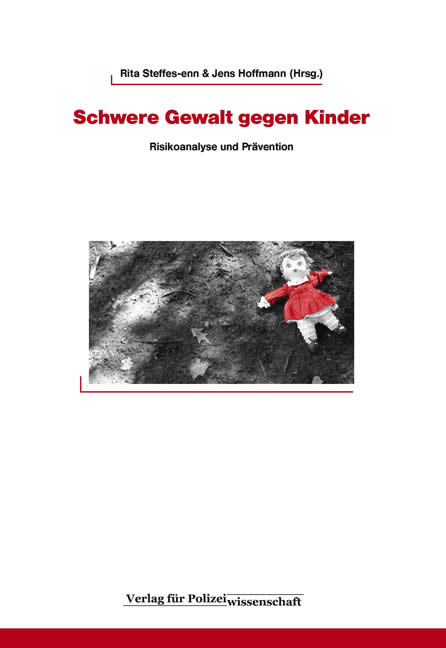Nicole Bartsch
Belastungs- und Führungserleben im Polizeidienst Einschätzung durch Vorgesetzte und Mitarbeiter sowie Zusammenhang mit Führungskräftetrainings

Da es bisher wenig differenzierte Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Belastungs- und Führungserleben im Polizeidienst gibt, wird dieses anhand einer Befragung in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt näher betrachtet. Nach einem überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu Stress in der Polizei und deren Auswirkungen wird der Zusammenhang zwischen Führung, psychischen Belastungen und Stressbewältigung dargestellt. Darauf aufbauend werden Zielsetzungen, zu klärende Fragestellungen sowie das verwendete Untersuchungsdesign und die gewonnenen Ergebnisse vorgestellt und anhand der eingangs aufgestellten Fragestellungen und Hypothesen diskutiert. Darüber hinaus stellt die Autorin interessante überlegungen an, welche Interventionen angesichts der Untersuchungsergebnisse und bestehender knapper Ressourcen besonders effektiv und wichtig zu sein scheinen.
Inhalt
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
I. Einleitung
II. Theoretischer Hintergrund
1. Die Rolle von psychischen Belastungen im Polizeiberuf
1.1 Die Polizei - ein stressintensiver Beruf
1.2 Die psychosoziale Belastungssituation in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt
2. Auswirkungen von Stress
2.1 Gesundheitliche Auswirkungen von psychischen Belastungen
2.2 Bedeutsamkeit von vorhandenen riskanten Verhaltens- und Erlebensmustern für die psychische Belastbarkeit
2.3 Zusammenhang zwischen Stress und Berufszufriedenheit
2.4 Zusammenhang zwischen Stress und Arbeitszufriedenheit
2.5 Einfluss von Selbstwirksamkeit auf Gesundheit und Leistung
3. Zusammenhang zwischen Führung, psychischen Belastungen und Stressbewältigung
3.1 Aspekte eines erfolgreichen Führungsverhaltens
3.2 Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen, Führungsverhalten und Fehlzeiten
3.3 Ein Führungsstil als Stressbewältigungsstrategie?
4. Interventionsmöglichkeiten
4.1 Intervention durch Verhaltenstrainings
4.2 Prävention durch Verhaltenstrainings in der Polizei
4.3 Implementierung von Trainingserfahrungen in den Berufsalltag
III. Untersuchungsmethodik
1. Zielsetzungen und allgemeine Fragestellungen
2. Differenzierte Fragestellungen und Hypothesen
2.1 Studie I
2.2 Studie II
3. Messinstrumente
3.1 Studie I
3.2 Studie II
3.3 Messung des Belastungserlebens
3.4 Messung des Führungsverhaltens
3.5 Messung des Lerntransfers und der Trainingswirksamkeit
4. Methode
4.1 Untersuchungsdesign
4.2 Zeitplan
5. Untersuchung
5.1 Durchführung, Beschreibung der Stichproben
5.1.1 Studie I - Befragung der Führungskräfte und Mitarbeiter
5.1.2 Studie II - Befragung der Trainingsteilnehmer
IV. Ergebnisse
1. Studie I - Befragung der Führungskräfte und Mitarbeiter
1.1 Deskriptive Ergebnisse nach Teilbereichen
1.1.1 Soziodemographische Auswertung 100
1.2 Belastungserleben und Erleben des Führungsverhaltens bei Führungskräften und Mitarbeitern in der Polizei
2. Studie II - Befragung der Trainingsteilnehmer
2.1 Deskriptive Ergebnisse nach Teilbereichen
2.1.1 Soziodemographische Auswertung
2.2 Belastungserleben und Erleben des Führungsverhaltens von Führungskräften im Trainingskontext
V. Vergleichende Diskussion der Ergebnisse
1. Belastungserleben
1.1 Unterschiedliches Belastungserleben bei Führungskräften und Mitarbeitern
1.2 Belastungserleben im Berufsvergleich
1.3 Belastungserleben der Führungskräfte in Abhängigkeit zur Weiterbildungserfahrung
1.4 Zusammenhang zwischen Dienstalter und Belastungserleben
1.5 Veränderung des Belastungserlebens durch Training
2. Führungsverhalten
2.1 Zusammenhang zwischen Belastungserleben der Mitarbeiter und dem Erleben des Führungsverhaltens
2.2 Führungsverhalten aus Sicht der Führungskräfte
2.3 Veränderung des Führungsverhaltens der Führungskräfte durch Training
3. Lerntransfer
3.1 Lerntransfer der Führungskräfte
4. Handlungsempfehlungen
4.1 Ausrichtung der Führungskräftetrainings auf das Führungsverhalten
4.1.1 Förderung der Weiterbildungsqualifizierung
4.2 Schaffung von Handlungs- und Entscheidungsspielraum
4.3 Durchführung von dienstaltersgruppenspezifischen Maßnahmen
5. Kritik und Ausblick
Cindy Krebs/Thomas-Gabriel Rüdiger
Gamecrime und Metacrime - Strafrechtlich relevante Handlungen im Zusammenhang mit virtuellen Welten
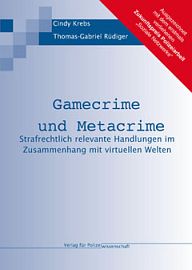
Gibt es Kriminalität im Zusammenhang mit virtuellen Welten? Wie sind die Erscheinungsformen, das Aufkommen im Hell- und Dunkelfeld? Sind die Delikte vergleichbar zu denen der realen Welt, in der wir tatsächlich leben? Obwohl World of Warcraft, Herr der Ringe Online oder auch Second Life bereits Bestandteile unseres Lebens sind, blieben diese Fragen von der Kriminologie bisher weitestgehend unbeantwortet. Den Autoren gelingt es mit ihrer an der Universität Hamburg im Studienfach Kriminologie vorgelegten Abschlussarbeit, ein erstes Grundlagenwerk zu Kriminalität im Zusammenhang mit virtuellen Welten für den deutschsprachigen Raum zu schaffen. Hierbei werden die bisher offenen Fragestellungen beantwortet und erstaunliche Ergebnisse aufgezeigt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen es Praktikern der Strafverfolgungsbehörden und im sozialen Bereich engagierten Personen ermöglichen, einen tieferen Einblick in diesen Phänomenbereich zu erlangen und ihnen die Gelegenheit bieten, den bislang im Verborgenen weilenden Blick auf Gefahren zu schärfen. Aber auch dem allgemein an virtuellen Welten oder Kriminologie interessierten Leser eröffnet dieses Buch einen erstaunlichen Blick auf ein neuartiges Themenfeld.
„Krebs und Rüdiger nehmen sich eines Themas an, welches im Alltagsgeschehen der letzten Jahre einen immensen Stellenwert eingenommen und dennoch (noch) nicht als kriminologisches Thema erkannt wurde. […]. Selten weist eine Arbeit derart umfangreiche Explorationen und zugleich wirklich neue Einsichten in ein unbekanntes und zugleich alltägliches Milieu auf, wie dies in der vorliegenden Arbeit […] geschieht.“
Dr. Bettina Paul, Institut für Kriminologische Sozialforschung, Universität Hamburg „Ihre eigenen Vorschläge zum Umgang mit Game- und Metacrime zeigen beeindruckend wie sehr sie im Hinblick auf internationale Literatur à jour sind […].“ Prof. Dr. Sebastian Scheerer, Leiter des Instituts für Kriminologische Sozialforschung, Universität Hamburg
Inhalt
1. Einleitung
2. Virtuelle Welten
2.1 Online-Rollenspiele (Games)
2.1.1 Entwicklung
2.1.2 Ziele und Motivation
2.1.3 Spielmechanik
2.1.4 ökonomie
2.1.5 Interaktion
2.1.6 Technische Voraussetzungen
2.2 Lebenssimulationen (Metaversen)
2.2.1 Entwicklung
2.2.2 Ziele und Motivationen
2.2.3 Ablaufmechanik
2.2.4 ökonomie
2.2.5 Interaktion
2.2.6 Technische Voraussetzungen
2.3 Abgrenzung zu Browsergames und Offline-Computerspielen
3. Methodik
3.1 Erhebung bei Betreibern virtueller Welten
3.2 Internetsicherheitsfirmen
3.3 Gerichtsdokumente
3.4 Bundesweite Anzeigenerhebung
3.5 Informelle Gespräche
3.6 Online-Erhebung
3.7 Ingame-Pranger
3.8 Feldforschung
4. Hellfeldausschnitt
4.1 Ergebnisse der bundesweiten Anzeigenerhebung
4.2 Kriminologische Betrachtung
4.3 Deliktische Dreiteilung
4.3.1 Meinungsäußerungsdelikte
4.3.2 Vermögensdelikte
4.3.3 Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung
4.4 Begleitkriminalität
5. Reaktionen
5.1 Formelle Reaktionen
5.1.1 Judikative und Kriminalpolitik
5.1.2 Strafverfolgungsbehörden
5.2 Informelle Reaktionen
5.2.1 Spieler
5.2.2 Betreiber
5.2.3 Wissenschaft
5.3 Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen
6. Risikologik virtueller Welten
7. Vorschläge zum Umgang mit Game- und Metacrime
8. Fazit
9. Forschungsperspektiven
10. Quellen – und Literaturverzeichnis
11. Abbildungsverzeichnis
12. Anlagenverzeichnis
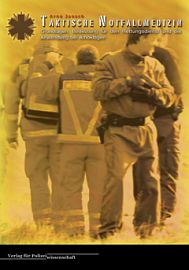
Die Taktische Notfallmedizin ist in Deutschland ein junges Themengebiet und wird z. B. vom Rettungsdienst bereitgestellt, um die Polizei bei speziellen Lagen zu unterstützen - beispielsweise bei einem Amoklauf im Rahmen des Rettungsteam-Konzeptes. Die Arbeit setzt dabei an, ob der Regelrettungsdienst nach heutigem Ausbildungs- und Ausstattungstand generell in der Lage ist, solche Situationen zu bewältigen - also mit äußerst begrenzten Ressourcen viele Patienten versorgen muss und herkömmliche Ausbildungssysteme, die einen frühzeitigen Transport kritischer Patienten vorsehen, nicht ohne Weiteres anwendbar sind. Zur Aufarbeitung der Fragestellung wurden mehrere Trainings in Schleswig-Holstein begleitet und die Problematik der regulären Ausstattung und Ausbildung gegenüber den Prinzipien des "Tactical Emergency Medical Support (TEMS)" detailliert untersucht, die international bereits ein eigenständiges Feld der präklinischen Notfallmedizin darstellen. Die notwendigen Änderungen in Ausbildung und Ausstattung werden ebenso genau beschrieben wie die erforderlichen Techniken: Schwerpunkte sind die Versorgung von Schuss- und Explosionsverletzungen sowie die effektive Kontrolle von Blutungen, wobei auch Algorithmen zum Umgang mit Tourniquets oder Hämostatika diskutiert werden. Die speziellen Rahmenbedingungen werden mit den Prinzipien moderner Traumamanagementsysteme ausführlich aufgearbeitet, ebenso wie die Sichtung und Versorgung bei Massenanfällen von Verletzten sowie der Patiententransport. Ferner wird auf die Basis eines realistischen und zeitgemäßen Einsatztrainings eingegangen; Rettungsdienst und Polizei erhalten so eine unentbehrliche Grundlage, die medizinische Versorgung bei Polizeieinsätzen modernen Prinzipien anzupassen und zu optimieren.
Inhalt
Einleitung
Grundlagen
Medizinische Grundlagen
Schussverletzungen
Explosionsverletzungen
Grundlagen des Rettungsdienstes
Gesetzliche Grundlagen des Rettungsdienstes
Ausbildungen im Rettungsdienst
Präklinisches Traumamanagement
Materielle Ressourcen
Personelle Ressourcen: Simulation
Phänomen Amok
Herkunft des Phänomens
Tätercharakteristik
Sonderform school shooting
Auswertungen
Lösungsansätze: Zusammenarbeit von Polizei und Rettungsdienst
Kritik am Modell des Rettungsteams
Tactical Emergency Medical Support (TEMS)
Behandlung im Bereich von TEMS
Systematische Bewertung von TEMS
Ausbildung, Techniken, Ausstattung und Training
Ausbildung
Spezielle Techniken und Ausstattung
Airwaymanagement
Kontrolle von Blutungen
Infusionstherapie
Hypothermie
Persönliche Grundausstattung
Patiententransport
Traumataschen
Reanimation nach Trauma
Triage
Schmerztherapie
Fernbeurteilung
Reizgase
Zusammenfassung
Training
Fazit
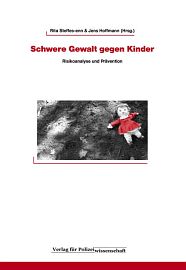
Schwere Gewalttaten gegen Kinder geschehen oft durch Eltern oder andere nahe stehende Personen. Der vorliegende Band versammelt Beiträge von Experten, die nicht alleine wissenschaftlich, sondern auch praxisnah tätig sind. So wird eine vielschichtige Sicht auf das Phänomen „Schwere Gewalt gegen Kinder“ ermöglicht und das neueste Fachwissen sowie Handlungsansätze für die Praxis vorgestellt.
Das Buch richtet sich an Fachleute unterschiedlichster Disziplinen, die mit der Risikoanalyse und der präventiven Arbeit befasst sind, um schwere Gewalttaten gegen Kinder zu verhindern. Es geht um das Erkennen, Einschätzen und Entschärfen von Risikosituationen.
Inhalt
Inhalt
Risiko- und Schutzfaktoren bei Kindeswohlgefährdung/Kindesmisshandlung
Günther Deegener
Wenn Eltern ihre Kinder töten – Ein überblick über den gegenwärtigen Kenntnisstand
Justine Glaz-Ocik & Jens Hoffmann
Frauen als Täterinnen
Nahlah Saimeh
Familizid - Kinder als weitere Opfer bei Tötungsdelikten durch Intimpartner
Jens Hoffmann & Justine Glaz-Ocik
Neutralisierung und Täterschaft
Rita Steffes-enn
Interdisziplinäres Fallmanagement zur Frühesterkennung von Hochrisiko-Familien
Wilfried Kratzsch

Bei der vorliegenden Ausarbeitung handelt es sich um eine Adaption des Buchs „Psychologische Krisenintervention für Einsatzkräfte“ auf die Belange von Opfern von Banküberfällen. Es bietet primär ein Verständnis für das Problem des „Überfallen-werdens“ und zeigt Lösungswege für hieraus entstehenden Probleme auf.
Dieses Buch bietet für alle an diesem Thema Interessierten (Bankangestellte, Vorgesetzte, Vorstände, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsratmitglieder, ...) umfassende und praxisnahe Informationen zur psychologischen Krisenintervention bei Überfallopfern. Nach einer lebensnahen Darstellung der theoretischen Hintergründe folgt eine umfassende Darstellung praktischer Maßnahmen der psychologischen Krisenintervention. Hierbei wird nicht nur die Nachsorge sondern auch die Vorsorge, die Vorbereitung auf Banküberfälle, ausführlich erläutert. Abschließend werden die Voraussetzungen sowie erforderlichen Aus- und Weiterbildungsinhalte für Krisenhelfer dargestellt.
Der Autor
Frank Hallenberger, Dr. rer. nat., Diplompsychologe, Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Fachbereich Polizei in Rheinland-Pfalz, Polizeipsychologe, Leiter des Kriseninterventionsteams der Polizei Rheinland-Pfalz, Klinischer Hypnosetherapeut, Trainer, Ausbilder, Betreuer
Inhalt
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Gründe für Krisenintervention
3 Traumatischer Stress
3.1 Belastung, Beanspruchung und Stress
3.2 Trauma
3.3 Schutz-, Risiko- und Ereignisfaktoren
3.4 Reaktionen auf Traumata
3.5 Langfristige Aspekte von Traumata
3.6 Psychophysiologie
3.7 Traumatisierungen nach Banküberfällen
4 Krisen und Interventionen
4.1 Krisen
4.2 Interventionen
4.3 Psychologische Krisenintervention
4.4 Ziele psychologischer Krisenintervention
4.5 Critical Incident Stress Management (CISM)
5 Grundlagen
5.1 Allgemeine Überlegungen
5.2 Interaktion und Konfrontation
5.3 Psychoedukation
5.4 Ressourcen und Bewältigung
5.5 Soziale Unterstützung
5.6 „Aufnehmen und Stützen“ – „Take Up and Back Up“
5.7 Phasen
5.8 Krisenintervention und Psychotherapie
5.9 Die Beteiligten
5.10 Kontraindikationen psychologischer Krisenintervention
6 Praxis der Krisenintervention
6.1 Erste Phase: Psychische Erste Hilfe (t + X Minuten) –Psychological First Aid
6.2 Zweite Phase: Akut Intervention (t + X Stunden) – Acute Intervention
6.3 Dritte Phase: Psychologische Aufarbeitung (t + X Tage) – Psychological Working Up
6.4 Vierte Phase: Nachsorge (t + X Wochen) – Follow up
6.5 Primäre Prävention
7 Wirkmechanismen und Ausbildung
7.1 Wirkmechanismen
7.2 Krisenhelfer
8 Fazit
8.1 Programmvorschlag
8.2 Schlusssatz
9 Glossar
10 Literatur
11 Sachregister

Der Band fokussiert auf Kommunikation, situative Einschätzung und Interventionsstrategien auch außerhalb der Gefängnismauern mit potentiell gefährlichen Personen. Die Autoren verfügen allesamt über einschlägige praktische Erfahrungen im Umgang mit Gewalttätern; aus unterschiedlichen Professionen und Arbeitsfeldern stammend werden wertvolle Methoden, Strategien und Vorgehensweisen zusammengetragen. Er liefert Praktikern Handwerkszeug in vielfacher Hinsicht, angefangen von handfesten Gesprächsstrategien über Risikoeinschätzungen – auch für die eigene Sicherheit bis hin zur konkreten Umsetzung von Interventionsmaßnahmen. Der Band richtet sich an unterschiedliche Berufsgruppen, wie z.B. Polizei, Sozialarbeit, Psychiatrie, Psychologie und Beratungsstellen.
Inhalt
Inhalt:
Gefährdungseinschätzung in konfliktträchtigen Gesprächssituationen mit Migrantenfamilien
Corinna Ter-Nedden
Deliktbezogene Gesprächsführung mit Gewalttätern
Rita Steffes-enn
Täteransprache – Denkmuster, Körpersprache und Wahrnehmung des Gegenübers nutzen
Markus Brand
Opferwahrnehmungsseminare mit inhaftierten Gewalttätern
Frank J. Robertz
Gefährliche Expartner – Psychologische Hintergründe und Interventionsgespräche in Fällen von Stalking
Jens Hoffmann
55
Das Instrument der Gefährderansprache als Maßnahme im integrierten Gefährdungslagenmanagement
Carsten Schenk
Wer stört? Täterbezogene Intervention durch die Polizei
Karsten Schilling
Gefährdungsanalyse und Gefährderansprache - Kernelemente des polizeilichen Bedrohungsmanagements
Andreas Stenger

In den letzten Jahren hat sich im Umgang mit häuslicher Gewalt vieles
getan. Was in der Gesellschaft lange als Privatangelegenheit galt, die keine
Einmischung von außen erfordert, ist nun zum Thema für Opfereinrichtungen,
der Polizei und auch der Justiz geworden. Obgleich Betroffene zumeist nun
Ansprechpartner finden, ist bei der Frage der Prävention und des Fallmanagements
noch vieles offen. So sterben jährlich etwa 300 Frauen in Deutschland
durch die Hand ihres Expartners, – Fälle, die das Potenzial haben
durch zielgerichtete Maßnahmen geschulter Helfer verhindert zu werden.
Dieses Buch liefert zum einen Informationen über die Hintergründe
von häuslicher Gewalt und die damit einhergehenden Belastungen für
die Opfer. Die Autoren stellen aber auch Methoden vor, um Fälle und deren
Eskalationspotenzial konkret einzuschätzen und um ein individuelles Fallmanagement
zu entwickeln. Dabei finden auch besondere Aspekte Berücksichtigung wie
der Umgang mit Kindern in gewaltbelasteten Familien, Gewalt und Ehrenmorde
bei Migrantinnen sowie Stalking und häusliche Gewalt. Führende Vertreter
ihres Feldes präsentieren hier den aktuellen »State of the Art«
– verständlich und didaktisch aufbereitet für Praktiker unterschiedlicher
Disziplinen.
Inhalt
Inhalt:
Gemeinsam gegen häusliche Gewalt: Kooperation, Intervention, Begleitforschung
Barbara Kavemann
Muster von Gewaltbeziehungen
Cornelia Helfferich
Der rechtliche Umgang mit häuslicher Gewalt
Dagmar Freudenberg
Zusammenhang von häuslicher Gewalt gegen
die Mutter mit Gewalt gegen Töchter und Söhne
Barbara Kavemann
Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern
und Jugendlichen
Else Döring
Tiermisshandlung im Kontext häuslicher
Gewalt
Heike Küken
Stalking und häusliche Gewalt
Jens Hoffmann & Isabel Wondrak
Familiäre Gewalt und Ehrenmorde bei Migrantinnen
Corinna Ter-Nedden
Prävention von Tötungsdelikten durch
Expartner
Uwe Stürmer
Verhinderung von Gewaltdelikten nach vorausgegangenen
Bedrohungen
Christian Menke & Karsten Schilling
Autorenvitae