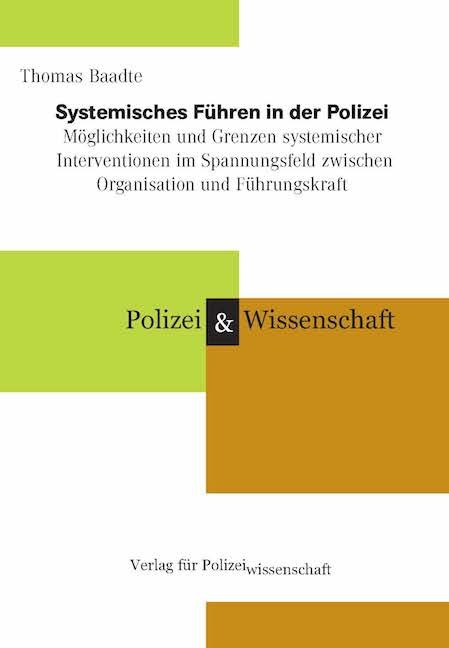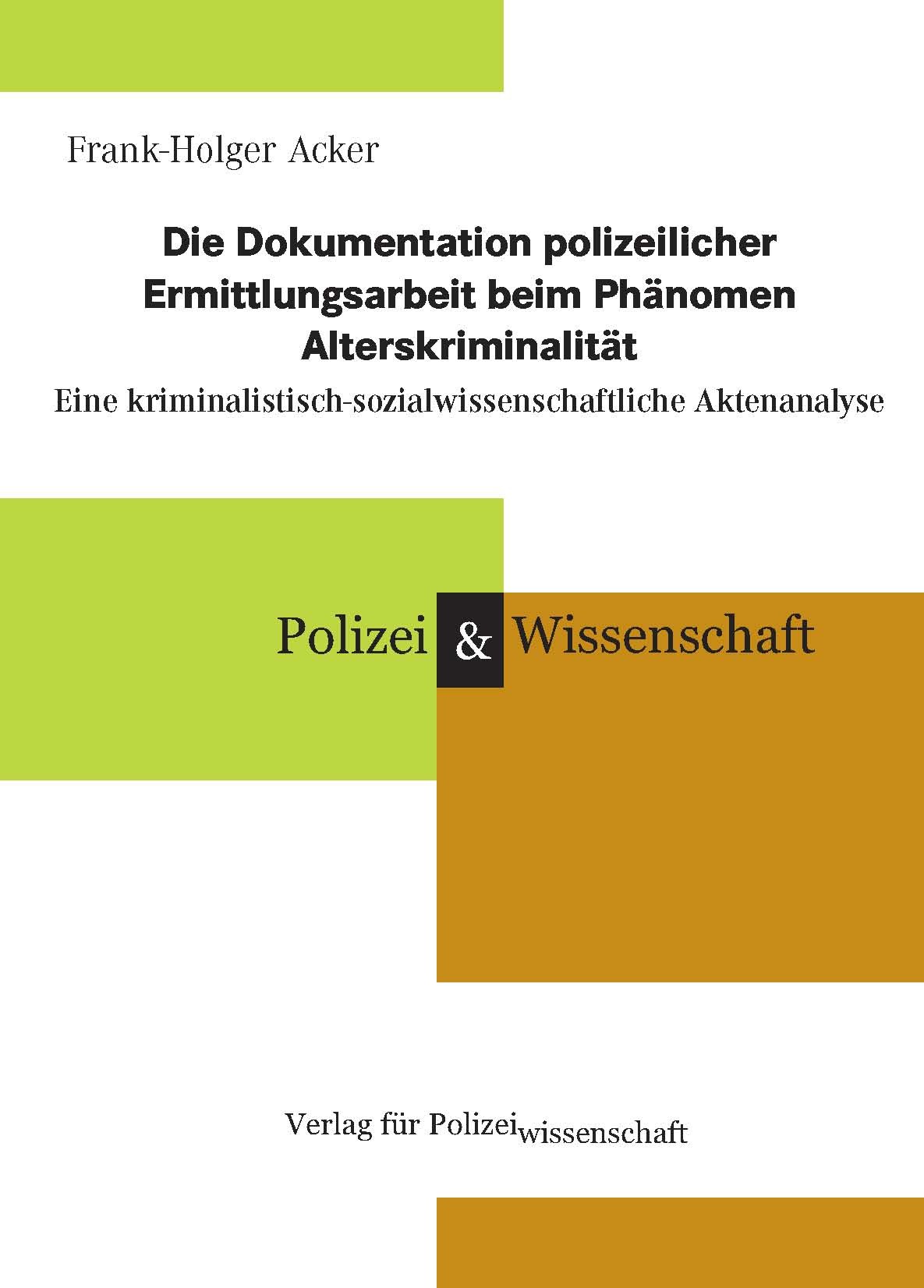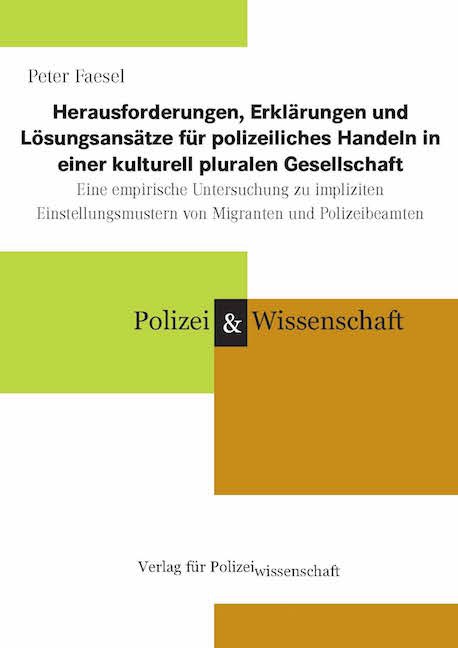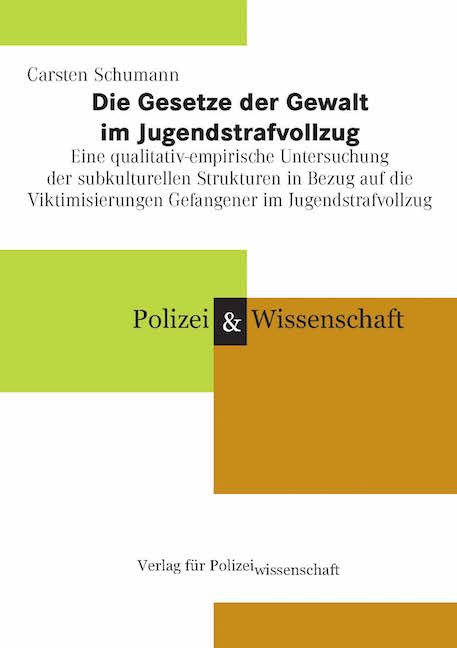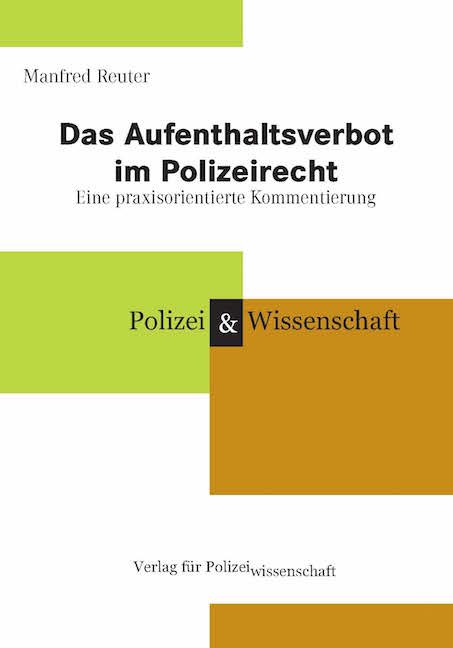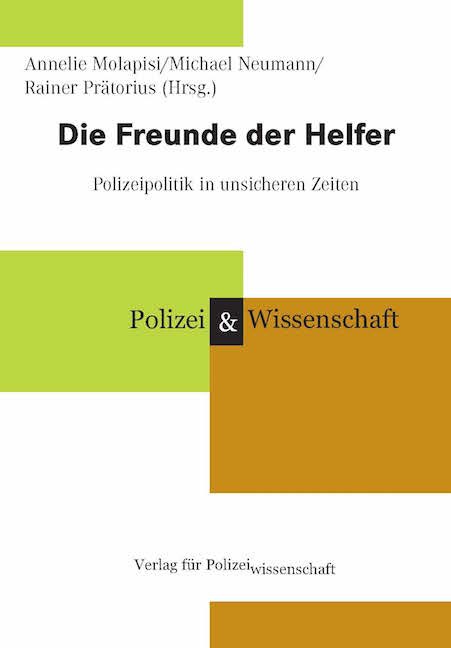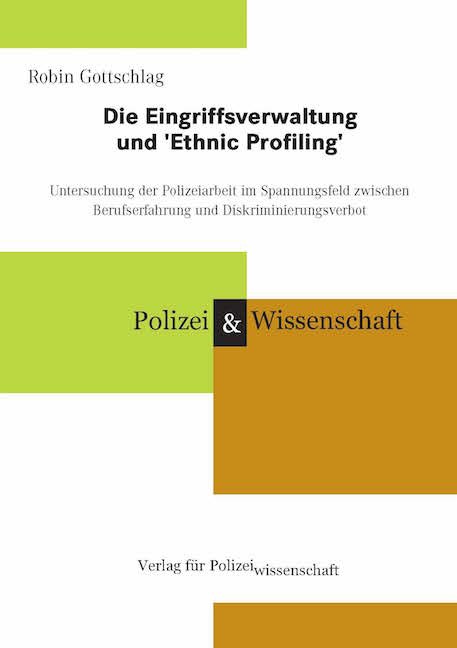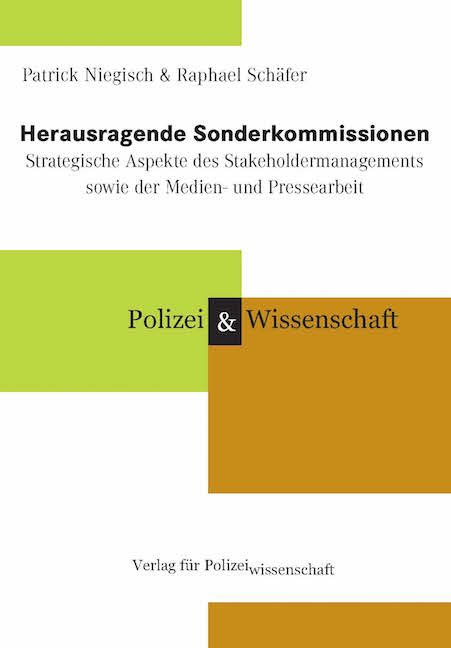Thomas Baadte
Systemisches Führen in der Polizei Möglichkeiten und Grenzen systemischer Interventionen im Spannungsfeld zwischen Organisation und Führungskraft
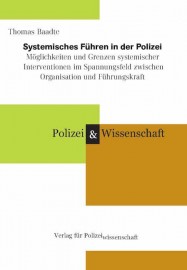
Quellen der literaturbasierten Arbeit sind sowohl themenbezogene wissenschaftliche Publikationen als auch Selbstbeschreibungen der Polizeiorganisationen. Ausgewählt werden einerseits theoriegeleitete Beschreibungen der Organisation als selbstreferenzielles System, andererseits praxisbezogene Publikationen zu systemischen Interventionsmethoden und
-instrumenten. Die Literatur wird entsprechend der zentralen Fragestellungen analysiert, mit bestehenden Vorschriften und Konzepten zur Führung in der Polizei verglichen und als Basis für die Fortentwicklung polizeilicher Führungskonzepte (beispielhaft Rheinland-Pfalz) verwendet.
Als Ergebnis wird festgehalten, dass der systemische Führungsansatz Grundsätzen für Führung und Zusammenarbeit in der Polizei entspricht. Er bietet deshalb vielfältige, anschlussfähige Möglichkeiten, das polizeiliche Konzept kooperativer Führung in den Dimensionen der strukturellen, interaktionellen und selbstreflexiven Führung fortzuschreiben. Vorgeschlagen werden systemische Methoden und Instrumente in den Bereichen Organisationsberatung, Strategie- entwicklung, Projektmanagement, Kommunikation und Personalentwicklung. Zugrunde liegen jeweils systemische Grundhaltungen und Einstellungen, die Führungsinterventionen in komplexen Systemen erst wirksam werden lassen.
Inhalt
Inhalt
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlegung
2.1. Kybernetik
2.2. Konstruktivismus
2.2.1. Radikaler Konstruktivismus
2.2.1.1. Kybernetik zweiter Ordnung
2.2.1.2. Autopoiesis
2.2.2. Sozialer Konstruktionismus
2.3. Theorie sozialer Systeme
2.4. Systemische Organisationstheorie
2.4.1. Kommunikation von Entscheidungen
2.4.2. Entscheidungsprogramme
2.4.3. Kommunikationswege
2.4.4. Personen
2.4.5. Organisationskultur
2.5. Personale Systemtheorie
2.6. Personzentrierte Systemtheorie
3. Systemisches Führen: Intervenieren im Spannungsfeld zwischen Autopoiesis und Allopoiesis
3.1. Rollenübernahme: Abschied vom Mythos planbaren Führungserfolgs
3.2. Nicht-Trivialisierung: Abschied vom Machermythos
3.3. Kontextsteuerung: Abschied vom Steuerungsmythos
3.4. Selbstreflexion: Blinde Flecken in der Kommunikation erkennen
3.5. Grundhaltungen: Voraussetzungen gelingender Intervention
3.6. Zwischenfazit
4. Die Polizeiorganisation – Ein soziales System
4.1. Polizeiliche Entscheidungsprämissen
4.2. Führung in der Polizei – Status quo
4.2.1. Führen nach Vorschrift – Das Kooperative Führungssystem (KFS)
4.2.2. Kooperative Führung – Ein Beispiel aus der Praxis
4.2.3. Ansätze zur Fortentwicklung des KFS
4.2.3.1. Transformationaler Ansatz
4.2.3.2. Soziologischer Ansatz
5. Möglichkeiten systemischen Führens in der Polizei
5.1. Interaktionelle Führungsinterventionen: Die systemische Gestaltung zwischenmenschlicher Kommunikation
5.1.1. Systemisches Fragen
5.1.2. Systemische Fragetypen
5.1.3. Anwendungsfelder
5.2. Introspektive Führungsinterventionen: Die Inanspruchnahme von Beratung zur Entscheidungsfindung und zur Selbstführung
5.2.1. Kollegiale Fallberatung für Führungskräfte
5.2.2. Coaching für Führungskräften
5.3. Strukturelle Führungsinterventionen: Die systemische Gestaltung organisationaler Rahmenbedingungen
5.3.1. Systemische Strategieentwicklung
5.3.2. Systemische Organisationsberatung
5.3.3. Systemisches Projektmanagement
5.3.4. Kompetenzorientierte Personalentwicklung
6. Grenzen systemischer Führung
6.1. Tradierte Entscheidungsprogramme
6.2. Strenge Hierarchie
6.3. Heroische Erwartungen an Führungspersonen
6.4. Gelebte Organisationskultur
7. Fazit und Ausblick
Anlagen
Literaturverzeichnis
Frank-Holger Acker
Die Dokumentation polizeilicher Ermittlungsarbeit beim Phänomen Alterskriminalität: Eine kriminalistisch-sozialwissenschaftliche Aktenanalyse
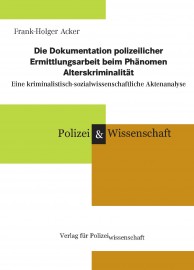
Der Autor war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit selbst Polizeibeamter in Hannover und sammelte bis zum Abschluss des Projekts vielseitige polizeiliche Erfahrungen vom uniformierten Dienst, über geschlossene Einsätze, bis hin zum Kriminaldauerdienst sowie der kriminalpolizeilichen Arbeit.
Dieses Buch bietet einen kriminalistisch-sozialwissenschaftlichen Blick auf die polizeilichen Ermittlungen beim Phänomen Alterskriminalität im Vergleich zu anderen Altersgruppen und schließt damit eine bisher bestehende Lücke.
Inhalt
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Demographischer Wandel und demographisches Altern
1.2 Alterskriminalität: Begriffsklärungen
1.3 Bedeutung des Phänomens Alterskriminalität
1.4 Forschungsstand zur Alterskriminalität und Aufbau dieser Arbeit
2 Strafbemessungsgründe im Rahmen der Ermittlungsarbeit
2.1 (Polizeiliche) Ermittlungen im Strafverfahren
2.2 Strafbemessung im allgemeinen Strafrecht
2.3 Anwendung der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch die Polizei
2.4 Bedeutung für die Erhebung: zu untersuchende Faktoren
3 Strafbemessungsgründe und Alter(n) in der Risikogesellschaft
3.1 Alter in der Risikogesellschaft
3.2 Einführung in die Alterstheorien
3.2.1 Defizitmodelle
3.2.2 Qualitative Verlaufsmodelle
3.2.3 Theorien des erfolgreichen Alterns
3.2.4 Weitere Alterstheorien und zusammenfassende Bedeutung für die Arbeit
3.3 Bourdieus Kapital-Theorie als Analyserahmen (des hohen Alters)
3.4 Kategorisierung der Strafbemessungsgründe nach Kapitalarten
4 Strafbemessungsgründe und Alterskriminalität
4.1 Altersspezifische Kriminalitätsbearbeitung: Jugendkriminalität
4.2 Positionierungen zu einem Altersstrafrecht in der Literatur
4.3 Kriminologische Ursachen der Alterskriminalität
4.3.1 Theorie der Schwäche
4.3.2 Labeling Approach
4.3.3 Mertons Anomietheorie
4.3.4 Die Allgemeine Kriminalitätstheorie
4.3.5 Der Life-Course-Ansatz
4.4 Polizeiliche Ermittlungen zur Strafbemessung bei älteren Straftätern
5 Datenauswahl: Methodik und Hypothesenbildung
5.1 Datenmaterial und Sampling: Hannoveraner Gerichtsakten
5.2 Hypothesenbildung als Grundlager einer heuristischen Analyse
5.3 Inhaltsanalyse: Kategorienbildung und Erläuterungen
5.4 Gütekriterien Analysebogen, Codierung und Pretest
6 Akten-Auswertungen
6.1 Beschreibung der Daten
6.2 Hinweise zur Codierung der Variablen
6.3 Auswertung 1: Darstellung einzelner Akten (Case Study)
6.3.1 Zur Gruppe „Allgemein ab 90 Jahre“
6.3.2 Zur Gruppe „60–79 Jahre Diebstahl“
6.3.3 Zur Gruppe „40–49 Jahre Diebstahl“
6.3.4 Zur Gruppe „15–17 Jahre Diebstahl“
6.3.5 Zur Gruppe „Allgemein 60–79 Jahre“
6.3.6 Zur Gruppe „Allgemein 40–49 Jahre“
6.3.7 Zur Gruppe „Allgemein 15–17 Jahre“
6.3.8 Zusammenfassung
6.4 Auswertung 2: Überprüfung Hypothesen
6.5 Auswertung 3: Konfigurationsfrequenzanalyse
6.5.1 Typen hinsichtlich des Ergebnisses des Strafverfahrens und der Kapitalart
6.5.2 Typen hinsichtlich des sozialen Kapitals und der Dienststelle
6.5.3 Typen hinsichtlich der Altersgruppen und Kapitale
6.5.4 Interpretation der Ergebnisse der KFA
7. Ergänzende Fallstudie in Form eines problemzentrierten Interviews
7.1 Methode des problemzentrierten Interviews und Wahl der Interviewten
7.2 Fragebogenerstellung
7.3 Auswertung 4: Ergebnisse des problemzentrierten Interviews
8. Resümee und Ausblick
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der vier durchgeführten Analysen
8.1.1 Wenig Kenntnis bezüglich Strafbemessungsgründen
8.1.2 Formelle Regelungen wirken sich förderlich auf die Dokumentation aus
8.1.3 Umfang der Dokumentation abhängig vom Beamten
8.1.4 Ab 60-Jährige werden nicht als alt wahrgenommen
8.1.5 Körperliche Veränderungen und Defizitmodell
8.2 Resümee
8.3 Reflexion und weiterer Forschungsbedarf
Literaturverzeichnis
Peter Faesel
Herausforderungen, Erklärungen und Lösungsansätze für polizeiliches Handeln in einer kulturell pluralen Gesellschaft Eine empirische Untersuchung zu impliziten Einstellungsmustern von Migranten und Polizeibeamten
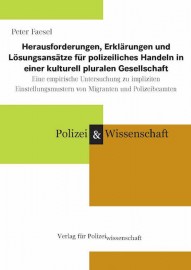
Zusätzlich wurde die kulturvergleichende Polizeiforschung systematisiert und daraufhin untersucht, inwieweit die gängigen Kulturmodelle als Orientierung im „kulturellen Dschungel“ der polizeilichen Arbeit dienen können. Aus den Ergebnissen wurden Implikationen für die polizeiliche Praxis und die weitere Forschung abgeleitet. Diese zielen letztendlich auf die Entwicklung einer kultursensibleren Polizei.
Vielleicht ist es ohnehin an der Zeit, den Wortteil „Poli“ in Polizei umzudeuten, um die „Viel“falt der Organisation im Inneren und die Ausrichtung auf die gesellschaftliche Diversität im Äußeren hervorzuheben. Schafft man es, Gegensätze zu integrieren, dann lassen sich auch Menschen integrieren. Durch professionelleren Umgang mit Diversität in einem pluralen Deutschland kann gerade die Polizei einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Menschen in respektvollerer Weise miteinander umgehen.
Inhalt
Inhalt:
2.2.1 DEFINITION „EINSTELLUNG“
3 Stand und Systematisierung der Forschung
3.7.3 MIGRANTEN IN DER POLIZEI
4 Theoretische Grundlagen zur empirischen Studie
4.1.4 KULTUREMTHEORIE
5 Empirische Untersuchung zu Einstellungen mit der REPERTORY GRID-TECHNIK
5.1.4 DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNG
6 Konsequenzen für die Praxis und die weitere Forschung
7 Zusammenfassung und Fazit
8 Literaturverzeichnis
Carsten Schumann
Die Gesetze der Gewalt im Jugendstrafvollzug – Eine qualitativ-empirische Untersuchung der subkulturellen Strukturen in Bezug auf die Viktimisierungen Gefangener im Jugendstrafvollzug

Es gibt bislang ein nur marginales systematisches kriminalsoziologisches Wissen über die Insassenkultur von Jugendgefängnissen und es fehlt an zusammenhängenden Beschreibungen und Analysen der sozialen Strukturen jugendlicher Gefangener. Dieses Buch stellt eine qualitativ-empirische Untersuchung vor, innerhalb welcher unter Berücksichtigung bestehender Konzepte von Subkulturen die selbstinterpretierten Erfahrungen der Gesprächspartner aus ihrer sozialen Gefängniswelt und ihrer erlebten Gewalt erhoben und schließlich theorie- und regelgeleitet analysiert wurden. Die Befunde dieser Studie zeigen am Ende nicht nur Regelmäßigkeiten des subkulturellen Miteinanders der jugendlichen und heranwachsenden Gefangenen auf, sondern verweisen auch im Speziellen auf die »Gesetze« der subkulturellen Gewaltentstehung im Jugendstrafvollzug.
Inhalt
Inhalt:
1.1 Jugendkriminalität und Gefängnis – aktuelle Bezugspunkte zwischen Fakten und Dramatisierung
2 Gewalt und Subkultur im Strafvollzug
2.3 Subkulturelle Gegenordnungen des Jugendstrafvollzuges
3 Methodische Aufbereitung des Untersuchungsfeldes
4 Erzählungen aus dem Feld – Kategorisierte Lebensmomente und Selbstpositionierungen von Gefangenen in der Jugendanstalt Raßnitz
5 Die Subkultur in der Jugendanstalt Raßnitz – Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
6 Fazit – Implikationen für den Jugendstrafvollzug
Literaturverzeichnis

Auch wenn gerichtliche Klagen eher die Ausnahme sind, so legen gerade diese Verfahren Schwächen in der Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen bzw. in der Begründung der Verbote durch die PolizeibeamtInnen offen. Dieses Buch verfolgt daher das Ziel, die diesbezügliche Handlungssicherheit zu optimieren.
Dazu werden die Tatbestandsmerkmale des § 34 II PolG NRW vorgestellt und unter Einbeziehung der Verwaltungsvorschrift, von vier „Standardkommentaren“ und der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung erläutert. In einem weiteren Kapitel und in den beiden Anhängen werden die in der Bundesrepublik bestehenden rechtlichen Möglichkeiten gegenübergestellt, so dass die hier am Beispiel von NRW exemplifizierte Auslegungen auf die diesbezüglichen Vorschriften übertragbar sind. Ein gesondertes Kapitel befasst sich mit den polizeilich relevanten Gesichtspunkten zum Aufenthaltsverbot als eine Form des Verwaltungsaktes und ein weiteres bietet Formulierungshilfen für Fallbegründungen. Die Broschüre schließt mit dem obligatorischen Quellen und Literaturverzeichnis.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
2 § 34 II PolG NRW - Aufenthaltsverbot
3 Synopse der Ermächtigungen in der Bundesrepublik
4 Das Aufenthaltsverbot als Verwaltungsakt
5 Formulierungshilfen
6 Quellen / Literatur
A n h a n g
Annelie Molapisi/Michael Neumann/Rainer Prätorius (Hrsg.)
Die Freunde der Helfer – Polizeipolitik in unsicheren Zeiten
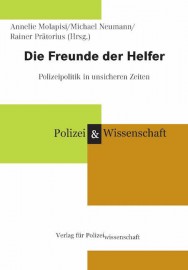
Es schreiben: Jochen Christe-Zeyse, Hans-Joachim Heuer, Heiko Maas, Galina Missel, Annelie Molapisi, Anne Nassauer, Rainer Prätorius, Rolf Ritsert, André Röhl, Frank Rutkowsky und Thorsten Voß.
Inhalt
Inhalt
Vorwort
1 „Rechtspolitik für eine moderne Gesellschaft“ (Heiko Maas)
2 Mehr Präsenz in der Fläche? Reformkonzepte einer Landespolizei auf dem Prüfstand (Jochen Christe-Zeyse)
3 Sicherheitsföderalismus zwischen Bundestreue und Partikularinteressen – am Beispiel der Bund-Länderübergreifenden polizeilichen Einsatzbewältigung (Rolf Ritsert)
4 Die Kooperation der Sicherheitsbehörden und das Trennungsgebot – Quadratur des Kreises? (Torsten Voß)
5 Konkurrenz oder Kooperation? Das Verhältnis zwischen Polizei und privater Sicherheit (André Röhl)
6 „Master of Disaster“ - Ein Beitrag zur Akademisierung
der Polizei“ (Hans-Joachim Heuer)
7 „Das Wissen um die Lebenswelt ist der Schifferknoten der Polizei“ – Umdenken in der Integrationsarbeit und Rekrutierung von Migranten und BewerberInnen mit Migrationshintergrund (Galina Missel)
8 Die Rolle der Polizei in der Ausländerpolitik (Annelie Molapisi)
9 Polizei und Protest - Einsatzplanung und situative Strategien zur Gewaltvermeidung (Anne Nassauer)
10 Seelsorge in der Polizei (Frank Rutkowsky)
11 Polizisten als Lokalpolitiker: Chiefs und Sheriffs in den USA (Rainer Prätorius)
Robin Gottschlag
Die Eingriffsverwaltung und 'Ethnic Profiling' Untersuchung der Polizeiarbeit im Spannungsfeld zwischen Berufserfahrung und Diskriminierungsverbot
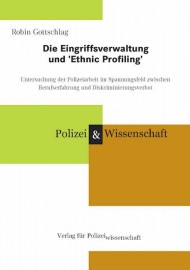
Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über die Lage in Deutschland und untersucht das Phänomen in sozialwissenschaftlicher Sichtweise mittels zweier Befragungen. Betroffene sowie Bürgerinnen und Bürger kommen zu Wort, und auch Polizeibedienstete wurden mit einbezogen. Die Wahrnehmungen des Problem gehen teilweise weit auseinander – Migranten fühlen sich häufiger kontrolliert. Drohen hierdurch Vertrauensverlust und Entfremdung? Diese Publikation ergänzt die bisherige Forschung im deutschen Kontext.
Inhalt
Inhalt
1 Einleitung
2 Theoretischer und empirischer Hintergrund
2.1 Begriffsbestimmung und Phänomenologie
2.2 Juristische Dimension
2.3 Bestand bisheriger Sozialforschung
2.4 Bedingungsfaktoren
2.4.1 Die Kultur der Polizei
2.4.2 Stereotypisierung durch Erfahrung
2.4.3 Dynamik der konflikthaften Kommunikation
3 Empirische Untersuchung
3.1 Befragung von Bürgerinnen und Bürgern
3.1.1 Design
3.1.2 Hypothesen
3.1.3 Durchführung
3.1.4 Stichprobe
3.1.5 Ergebnisse
3.2 Befragung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
3.2.1 Design
3.2.2 Hypothesen
3.2.3 Durchführung
3.2.4 Stichprobe
3.2.5 Ergebnisse
4 Diskussion der Ergebnisse beider Umfragen
5 Handlungsempfehlungen und Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Patrick Niegisch & Raphael Schäfer
Herausragende Sonderkommissionen Strategische Aspekte des Stakeholdermanagements sowie der Medien- und Pressearbeit
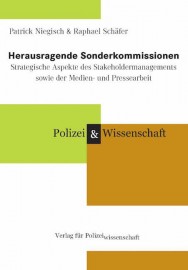
Der erste Teil befasst sich mit dem Stakeholdermanagement, welches den Gedanken der Projektarbeit mit der Arbeit einer Soko verknüpft und Hinweise auf den Umgang mit Anspruchsgruppen gibt. Im zweiten Teil wird die Perspektive der Medien- und Pressearbeit im Zusammenhang mit Sokos aus Anlass eines sexuell assoziierten Tötungsdelikts an Kindern betrachtet.
Die Autoren stellen die Ergebnisse ihrer empirischen Untersuchungen dar, geben einen Ausblick auf mögliche Optimierungsansätze in diesen herausragenden Fällen und versuchen mit ihrem Beitrag den Diskurs zur Sonderkommissionsarbeit fortzuführen.
Inhalt
Inhalt:
an Kindern
1. Einführende Betrachtung
2. Forschungsstand
2.1 Sexuell assoziierte Tötungsdelikte zum Nachteil von Kindern
2.1.1 Phänomenologie
2.1.2 Lagebild in der Bundesrepublik Deutschland
2.2 Arbeit von Sonderkommissionen in der Polizei
2.2.1 Begriffliche Abgrenzung
2.2.2 Wesensmerkmale einer Sonderkommission
2.2.3 Regelungen zur Soko-Arbeit in Bund und Ländern
2.3 Stakeholderanalyse und -management
2.3.1 Grundlagen
2.3.2 Stakeholderanalyse
2.3.3 Stakeholdermanagement
2.4 Sonderkommissionen und Berücksichtigung von Stakeholdern
3. Untersuchungsdesign
4. Ergebnisse der Erhebung
4.1 Vorbemerkungen
4.2 Identifizierte Stakeholder
4.3 Einfluss von Stakeholdern auf Sonderkommissionen in Fällen von sexuell assoziierter Kindstötung
4.3.1 Medien
4.3.2 Soko-Mitarbeiter
4.3.3 Vorgesetzte Stellen und Behördenleitung
4.3.4 Innenministerium
4.3.5 Staatsanwaltschaft
4.3.6 Angehörige der Opfer
4.3.7 Bevölkerung
4.3.8 Kommunalpolitische Akteure
4.3.9 Sonstige Stakeholder
4.4 Stakeholdermanagement
4.5 Stakeholderanalyse
4.6 Unterschiede zu anderen Sonderkommissionen
5. Ausblick auf weitere Forschung
6. Handlungsempfehlungen und abschließende Betrachtung
7. Literatur- und Quellenverzeichnis
Teil 2 - Medien- und Pressearbeit von Sonderkommissionen bei Sexualmorden an Kindern
1. Thematische Einführung
2. Stand der Forschung
3. Untersuchungsgegenstand
4. Methodisches Vorgehen
4.1 Experteninterviews
4.2 Dokumentenanalyse
5. Begriffsbestimmungen
5.1 Sexuell assoziierte Tötungen zum Nachteil von Kindern
5.2 Polizeiliche Pressearbeit
6. Ergebnis der Untersuchungen
6.1 Analyseergebnisse der Experteninterviews
6.1.1 Aufbauorganisatorische Anbindung der polizeilichen Pressearbeit
6.1.2 Betreuung der Opferfamilie im Umgang mit den Medien
6.1.3 Aussagen zum Medienkonzept
6.1.4 Ergänzungen zur Medien- und Pressearbeit
6.2 Reflexion des Untersuchungsgegenstandes und der Hypothesen
7. Diskussion der Ergebnisse
8. Handlungsempfehlungen
9. Ausblick / Fazit
10. Literaturverzeichnis