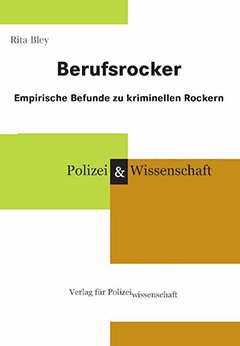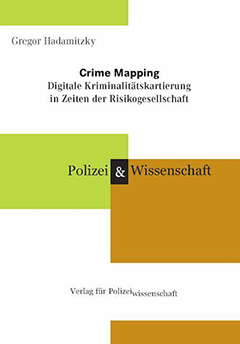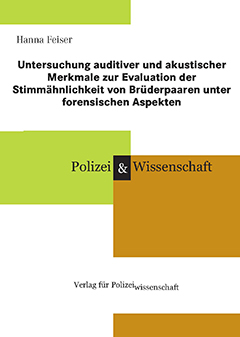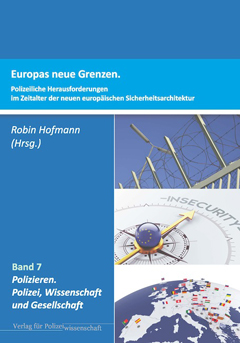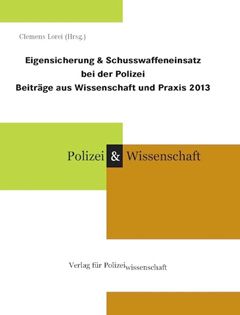Christian Pundt
Die Bewältigung von polizeilichen Einsatzlagen unter Hochstress Untersuchung eines Trainings der niedersächsischen Polizei aus psychologischer Sicht
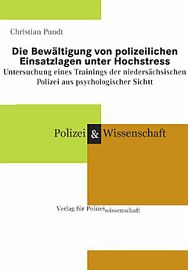
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
2. Zentrale Fragestellungen
3. Theoretische Grundlagen
3.1 Stressbelastungen innerhalb der Polizei
3.2 Stress
3.3 Stressmodelle
3.4 Akuter und chronischer Stress
3.5 Polizeitypische Stressbelastungen
3.6 Der polizeiliche Hochstress
3.7 Traumatischer Stress
3.8 Posttraumatische Belastungsstörungen
4. Folgen von Stress
4.1 Gesundheitliche Folgen
4.2 Leistungsfolgen durch Stressbelastungen
5. Methodik / Konzept
5.1 Versuchspersonen
5.2 Versuchsaufbau und Struktur
5.3 Versuchsobjekt
5.4 Versuchsablauf
5.5 Rater
5.6 Täter- und Opferdarstellung
6. Ergebnis
6.1 Subjektive Befragungen
6.2 Ergebnisse der subjektiven Befragungen
6.3 Geschlechtervergleiche in relevanten Bereichen
6.4 Auswertungen der Freitextantworten
6.5 Objektive Bewertungen
6.6 Ergebnisse objektive Merkmale
6.7 Herzfrequenz
7. Diskussion
8. Trainingsmodell und Tipps für die Praxis
8.1 Grundlagentraining ohne Einsatz von Stressoren
8.2 Vertiefungsstufe
8.3 Komplexe Trainingsinhalte
9. Literatur
10. Anhänge
Esther Hornung
Frauen die töten Eine empirische Untersuchung zur Phänomenologie weiblicher Tötungsdelinquenz in Hamburg: Polizeilich ermittelter Täterinnen im Zeitraum von 1990-2005

Inhalt
Inhalt:
I. EINLEITUNG
1. ZUM STAND DER EMPIRISCHEN FORSCHUNG VON FRAUEN ALS TäTERINNEN VON TöTUNGSDELIKTEN
2. FORSCHUNGSLEITENDE FRAGEN
II. ANNAHME UND ERKLäRUNGSANSäTZE ZUR FRAUENKRIMINALITäT: KRIMINOLOGISCHE THEORIEN–FRAGMENTE
1. BIOLOGISCH-ANTHROPOLOGISCHE ERKLäRUNGSANSäTZE
2. NEUERE BIOLOGISCHE ERKLäRUNGSANSäTZE
3. ROLLENTHEORIE
4. FEMINISTISCHE ANSäTZE
5. PSYCHOANALYTISCHER ANSATZ
6. THEORIE DER DIFFERENTIELLEN ASSOZIATION
7. MEHR-FAKTOREN-ANSäTZE
8. ZUSAMMENFASSENDE EINSCHäTZUNG DER ERKLäRUNGSANSäTZE ZUR FRAUENKRIMINALITäT
III. HELLFELDDATEN INTERNATIONAL ZUR ALLG. FRAUENKRIMINALITäT UND ZUR TöTUNGSKRIMINALITäT
1. USA
2. AUSTRALIEN
3. SCHWEIZ
4. RUSSLAND
5. WELT
6. ZUSAMMENFASSUNG
IV. HELLFELDDATEN NATIONAL UND REGIONAL ZUR ALLG. FRAUEN–KRIMINALITäT UND ZUR TöTUNGS–KRIMINALITäT
1. DIE AMTLICHEN STATISTIKEN
2. ENTWICKLUNG DER POLIZEILICH REGISTRIERTEN FRAUENKRIMINALITäT UND DER WEIBLICHEN TöTUNGSKRIMINALITäT AUF BUNDESEBENE, 1984-2013
3. ENTWICKLUNG DER FRAUENKRIMINALITäT UND WEIBLICHEN TöTUNGSKRIMINALITäT IN HAMBURG, 1984-2013
V. DETAILS DER PHäNOMENOLOGIE DER REGISTRIERTEN VORSäTZLICHEN TöTUNGSKRIMINALITäT HERANWACHSENDER UND ERWACHSENER TäTERINNEN IN HAMBURG IM ZEITRAUM VON 1990-2005
1. GEGENSTAND DER DATENERHEBUNG
2. DATENMATERIAL UND VORGEHENSWEISE
3. BESCHREIBUNG DES ERFASSTEN DATENMATERIALS
VI. SCHLUSSFOLGERUNG ZUR VORSäTZLICHEN TöTUNGSKRIMINALITäT VON FRAUEN UND AUSBLICK

Schlussendlich sollen Lösungsansätze für die Reduzierung von Polizeigewalt bzw. die Schaffung von mehr Transparenz zu besagtem Thema angeführt werden. Welche Maßnahmen sind für die Herstellung von Transparenz zu ergreifen und welche Veränderungen haben sich in den letzten Jahren hinsichtlich einer Transparenzsteigerung bereits vollzogen?
Inhalt
Inhalt:
1 EINLEITUNG
1.1 HINFüHRUNG ZUR FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
1.2 PROBLEME DER EMPIRISCHEN ERFORSCHUNG VON POLIZEIGEWALT
2 GRUNDLAGEN UND BEGRIFFE
2.1 TRANSPARENZ
2.2 BESCHREIBUNG DES STAATLICHEN GEWALTMONOPOLS UND DIE DEMOKRATISCHE LEGITIMATION DER POLIZEI
2.3 RECHTSWIDRIGE GEWALTANWENDUNG DURCH DIE POLIZEI UND KöRPERVERLETZUNG IM AMT (§ 340 STGB)
2.4 § 340 UND § 113 STGB: EINE GEGENüBERSTELLUNG
2.5 DAS LEGALITäTSPRINZIP UND SEINE GRENZEN BEI ERMITTLUNGEN GEGEN POLIZEIBEAMTE
3 FäLLE VON POLIZEIGEWALT IN DEUTSCHLAND SOWIE DARSTELLUNG IN UND KONTROLLE DURCH MEDIEN
4 RAHMENBEDINGUNGEN FüR POLIZEIGEWALT: DER AKTUELLE FORSCHUNGSSTAND
4.1 AUTHORITY MAINTENANCE THEORY
4.2 CONTROL BALANCE THEORY
4.3 POLIZEIKULTUR: INTERNE FüHRUNGSPROBLEME UND DIE INSTITUTION POLIZEI
4.4 POLIZISTENKULTUR: DIE MAUER DES SCHWEIGENS, KORPSGEIST, SUBKULTUR UND COP CULTURE
4.5 INDIVIDUELLE DEFIZITE UND OPFERERFAHRUNGEN
4.6 OPFER, TäTER UND SITUATIONEN
5 öFFENTLICHE KONTROLLE: AMNESTY INTERNATIONAL UND ANDERE ORGANISATIONEN
6 EMPIRISCHE DATENERHEBUNG
6.1 QUANTIFIZIERUNG VON VERFüGBAREN DATEN
6.1.1 POLIZEILICHE KRIMINALSTATISTIK UND STRAFVERFOLGUNGSSTATISTIK
6.1.2 UMGANG DER STAATSANWALTSCHAFT MIT VERFAHREN GEGEN POLIZEIBEDIENSTETE
6.1.3 KöRPERVERLETZUNGSDELIKTE NACH § 223 STGB UND DELIKTE INSGESAMT
6.2 INTERVIEWS
6.2.1 VORBEREITUNG, PROBLEME UND DURCHFüHRUNG DER INTERVIEWS
6.2.2 INTERVIEW 1: „DIE POLIZISTEN HABEN UNTEREINANDER SON KODEX“
6.2.3 INTERVIEW 2: „MAN WILL FUNKTIONIEREN“
7 ANALYSE DER DATEN: HERAUSSTELLUNG VON THEMENKOMPLEXEN RUND UM POLIZEIGEWALT
7.1 VORGEHEN DER ANALYSE
7.1.1 AUSWERTUNG DER QUANTITATIVEN DATEN: ABWEICHENDE ERLEDIGUNGSSTRATEGIEN?
7.1.2 AUSWERTUNG DER INTERVIEWS
7.2 ZUSAMMENFASSUNG UND GRENZEN DER ANALYSE
8 DIE HERSTELLUNG VON TRANSPARENZ UND ABSCHLIEßENDE BEMERKUNG
8.1 ANSäTZE ZUR VERHINDERUNG VON POLIZEIGEWALT
8.1.1 FEHLERKULTUR UND (MENSCHENRECHTS-) BILDUNG
8.1.2 KENNZEICHNUNGSPFLICHT FüR POLIZISTEN: IDENTIFIZIERUNG, PRäVENTIVE WIRKUNG UND TRANSPARENZ
8.1.2.1 Aktuelle Diskussion und Positionen in Deutschland
8.1.2.2 Der aktuelle Stand in den Bundesländern
8.1.3 EINFüHRUNG EINER UNABHäNGIGEN ERMITTLUNGSSTELLE
8.1.3.1 Ausgestaltung der Ermittlungsstellen
8.1.3.2 Der aktuelle Stand in den Bundesländern
8.1.3.3 Die Hamburger Polizeikommission und das Hamburger Dezernat Interne Ermittlungen
8.1.4 SMARTPHONES: üBERWACHUNG DURCH DEN BüRGER
8.1.5 ERHEBUNG VON STATISTIKEN: MöGLICHKEIT DER EMPIRISCHEN FORSCHUNG
8.2 ABSCHLIEßENDE BEMERKUNG
9 LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
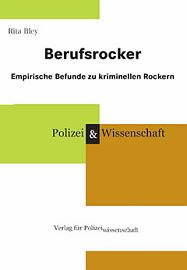
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Problemaufriss
1.2 Fragestellung
1.3 Methodische Vorgehensweise
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Definitionen/Grundannahmen
2.1 Rocker
2.2 Berufsrocker
2.3 Subkultur
2.4 Rockerkriminalität
3 (Sub-)Kultur der Rocker
3.1 Rekrutierungsmilieu
3.2 Motive für den Szeneeinstieg
3.3 Aufnahmeprozess
3.4 Hierarchie und Macht
3.5 Solidarität und Loyalität
3.6 Delinquenz
3.7 Gewalt
3.7.1 Gewaltbegriff im Rockermilieu
3.7.2 Gewaltvariationen
3.7.3 Gewaltkonstellationen
3.8 Zwischenfazit
4 ätiologie der Diversifizierung
4.1 Wandel der Strukturen
4.2 Einstellung und Beziehung zwischen alten und neuen Rockern
4.3 äußere Umstände
5 Subgruppentypologie
5.1 Ideologe
5.2 Neorocker
5.3 Schläger
5.4 Läufer
5.5 "Rocker ohne Kutte"
6 Prävention
7 Zusammenfassung/Fazit
Literatur
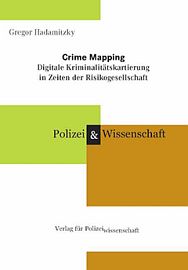
„Die Arbeit bietet für das aufkommende Feld des ‚Predictive Policing‘, insbesondere für den Aspekt des damit verbundenen ‚Crime Mapping‘ eine wichtige Reflexionsgrundlage, sowohl
wissenschaftlich, aber eben vor allem auch mit weitreichenden Bezügen und Anregungen für die Praxis“ (Dr. habil. Nils Zurawski, Institut für Kriminologische Sozialforschung, Universität Hamburg).
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
2. Kriminalitätskontrolle in der Risikogesellschaft
2.1 Risikogesellschaft
2.1.1 Kernaussagen und Entwicklung - Verschiebung der Präferenz
2.1.2 (Un-)Sicherheit, Rationalität und Vorsorge
2.2 Kriminalitätskontrolle
2.2.1 Kriminalitätskontrolle, Kriminalitätsbekämpfung und Polizieren
2.2.2 Auswirkungen
3. Kriminalitätskartierungen als Instrument der Kriminalitätskontrolle
3.1 Kernbegriffe und Ziele der digitalen Kriminalitätskartierung
3.2 Historische Entwicklung
3.3 Theoretische Grundlagen und kriminalpolitische Implementierung
3.4 Bestandsaufnahme und Fortentwicklungen
4. Problemorientierte Betrachtung
4.1 Aspekte der Kriminalgeographie - Diskurs Kriminalität und Raum
4.2 Macht der Karte - Effekte der Visualisierung
4.2.1 Konstruktion und Produktion von Sinnzusammenhängen
4.2.2 Stigmatisierung und Kriminalitätsfurcht
4.3 Datengrundlage
4.3.1 Schwerpunktsetzung und Self Fulfilling Prophecy
4.3.2 Mangel an Evaluation
5. Mögliche Konsequenzen für die Polizei und andere Akteure
6. Schlussbetrachtung und Ausblick
7. Abkürzungsverzeichnis
8. Anlagen
9. Internetverzeichnis
10. Literaturverzeichnis
Hanna Feiser
Untersuchung auditiver und akustischer Merkmale zur Evaluation der Stimmähnlichkeit von Brüderpaaren unter forensischen Aspekten
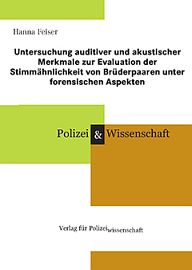
Anhand von drei Fragestellungen werden folgende Themen untersucht:
(1) Können Brüder perzeptiv an ihren Stimmen erkannt werden?
(2) Werden die Stimmen von Brüdern perzeptiv eher verwechselt als die von Nicht-Brüdern?
(3) Unterscheiden sich Brüder in Bezug auf ausgewählte akustische Merkmale in geringerem Maße als Nicht-Brüder?
Dabei wird evaluiert, ob die Brüderstimmen in zwei Perzeptions experimenten perzeptiv verwechselt werden und ob dieser Effekt bei Sprachaufnahmen über Mobiltelefon bestärkt wird. Des Weiteren wird vor dem Hintergrund forensischer Fragestellungen untersucht, ob sich die akustischen Sprechermerkmale der mittlere Grundfrequenz, der Variations koeffizient, die Vokalformanten und die Sprechgeschwindigkeit der Brüder unterscheiden oder eher ähnlicher sind im Vergleich zu nicht-verwandten Sprechern.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die auditive ähnlichkeit von Brüdern sehr gut perzeptiv nachweisen lässt. Diese ähnlichkeit ist jedoch bis auf eine Ausnahme beim Variationskoeffizienten nicht in den hier untersuchten vier akustischen Sprechermerkmalen begründet. Dies bedeutet, dass die Stimmen der Brüder anhand dieser akustischen Merkmale voneinander unterschieden werden können. Dieses Ergebnis stellt einen sehr wichtigen Beitrag für die forensische Fallarbeit dar.
Inhalt
Inhalt:
DANKSAGUNG
ZUSAMMENFASSUNG
PHONETISCHE SCHRIFT FüR DIE DEUTSCHE SPRACHE
1 EINLEITUNG
1.1 Phonetik und Forensische Phonetik
1.1.1 Forensische Stimmenanalysen
1.1.2 Forensische Stimmenvergleiche
1.2 Untersuchungsgegenstand
2 FORSCHUNGSSTAND
2.1 übersicht anderer Studien
2.2 Studien zur Stimmähnlichkeit
2.3 Studien mit verwandten Sprechern
2.3.1 Untersuchungen mit Zwillingsstimmen
2.3.2 Untersuchungen mit Geschwisterstimmen
2.4 Sonstige Studien
3 HYPOTHESEN
3.1 Perzeption I: Fragestellung und Hypothese
3.2 Perzeption II: Fragestellung und Hypothesen
3.3 Akustik: Fragestellung und Hypothesen
4 SPRACHMATERIAL
4.1 Sprecher
4.2 Sprachmaterial
4.2.1 Gelesene Sprache
4.2.1.1 Berliner Sätze
4.2.1.2 Minimalpaare
4.2.2 Spontane Sprache
5 METHODE
5.1 Experimentaufbau
5.1.1 Sprachaufnahme-Set-Up
5.1.2 Aufgabenstellung
5.2 Vorverarbeitung
5.2.1 WebMaus
5.2.2 Praat
5.2.3 Emu, R und Emu-R
5.3 Auditive Analysen
5.3.1 Perzeption I
5.3.2 Perzeption II
5.4 Akustische Analysen
5.4.1 Mittlere Grundfrequenz (f0)
5.4.2 Variationskoeffizient (VarKo)
5.4.3 Vokalformanten
5.4.4 Sprechgeschwindigkeit
6 ERGEBNISSE
6.1 Auditive Analysen
6.1.1 Perzeptionsexperiment I
6.1.2 Perzeptionsexperiment II
6.2 Akustische Analysen
6.2.1 Mittlere Grundfrequenz
6.2.2 Variationskoeffizient
6.2.3 Vokalformanten
6.2.4 Sprechgeschwindigkeit
7 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND DISKUSSION
7.1 Schlussfolgerungen zu den empirischen Ergebnissen
7.1.1 Auditive Ergebnisse
7.1.2 Akustische Ergebnisse
7.2 Diskussion und Einordnung der Ergebnisse
7.2.1 Vergleiche zu den auditiven Analysen
7.2.2 Vergleiche zu den akustischen Analysen
7.2.3 Erkenntnisse aus den Ergebnissen
8 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
8.1 Zusammenfassender Rückblick
8.2 Offene Fragestellungen für zukünftige Forschungsarbeiten
8.2.1 Zukünftige auditive Untersuchungen
8.2.2 Zukünftige akustische Untersuchungen
LITERATURVERZEICHNIS
Robin Hofmann (Hrsg.)
Europas neue Grenzen Polizeiliche Herausforderungen im Zeitalter der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur

Inhalt
Inhalt:
Teil 1: Neue Grenzen in Europa
Wiechmann, Martin
Europäische Grenzsicherung und Etikettierungsansatz – Entsteht illegale Migration durch Gesetzgebung?
Weitkunat, Gerhardt
Grenzpolizei mit globalisiertem Lagebild – Ursächliche Strategien gegen irreguläre Migration
Dienstbühl, Dorothe
Europäische Bekämpfungsstrategien gegen Terrorismusfinanzierung und Organisierte Kriminalität auf dem Prüfstand
Teil 2: Neue Entgrenzung von Polizeiaufgaben
Weber, Aleta
Polizeiaufbau in der Islamischen Republik Afghanistan: Welchen Herausforderungen müssen sich externe Akteure beim Export exekutiver Strukturen stellen?
Tiefenbach, Bernd
Policing Cross Border Crime in Europe – A comparative study on Transnational Policing and Inter-EU Law enforcement corporation
Ruhland, Bernhard
Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven der mitteleuropäischen Polizeiakademie MEPA
Teil 3: Neue polizeiliche und gesellschaftliche Herausforderungen
Feltes, Thomas
Community Policing – ein Modell für Länder im oder nach einem gesellschaftlichen Umbruch?
Feltes, Tilmann
Jugend und Sicherheit in Countries in Transition. Das Beispiel Kosovo
Clemens Lorei (Hrsg.)
Eigensicherung & Schusswaffeneinsatz bei der Polizei Beiträge aus Wissenschaft und Praxis 2013

Inhalt
Inhaltsverzeichnis:
Gewalt gegen Polizeikräfte aus Tätersicht – Eine kriminologische Untersuchung
Rita Steffes-enn
Gewalt gegen Polizeibeamte - Perspektiven von Betroffenen
Thomas Görgen, Andreas Belger, Rüdiger Fink, Andrea Hartmann, Johannes Schütze, Janine Quenstedt und Matthias Wied
Gewalt gegen Polizeibeamte – Eine Analyse der übergriffe am Beispiel von Einsatzsituationen im Rahmen von Familienstreitigkeiten und Gewalt in engen sozialen Beziehungen
Frank Wimmel
Posttraumatische Belastungsreaktionen nach Gewalterfahrungen bei Polizeibeamten– ein Vergleich verschiedener Dienstgruppen
Karoline Ellrich
Die Bewältigung von Hochstressphasen durch die Polizei – Evaluation eines Trainings der niedersächsischen Polizei aus psychologischer Sicht
Christian Pundt
Threat, anxiety, and police officers shooting behaviour under pressure
Arne Nieuwenhuys
Erscheinungsbild und verbale Kommunikation von Polizeibeamten
Max Hermanutz
Der polizeiliche Waffengebrauch im rechtlichen Prüfungsverfahren - Praxis trifft auf Recht
Rudolf Pföhs
Wie ist ein Kampf mit Anwendung von Schusswaffen?
Alain Smeets
Psychologische Grundlagen einsatztaktischen Vorgehens bei psychisch auffälligen Personen für die österreichische Bundespolizei
Katharina Schiefer
Vom Gelatineblock zum Kopfmodell: Fortschritte der Wundballistik
Christian Schyma