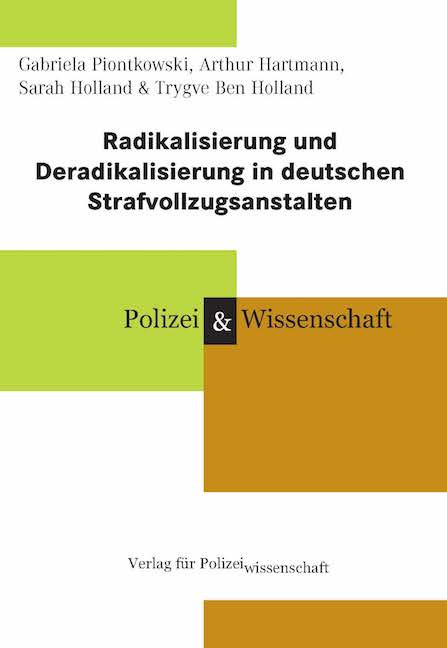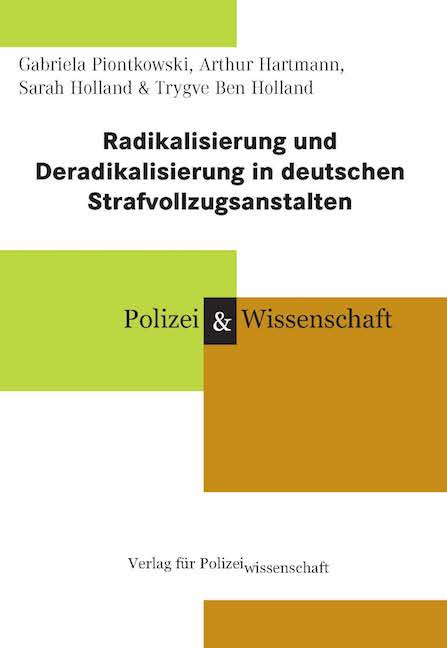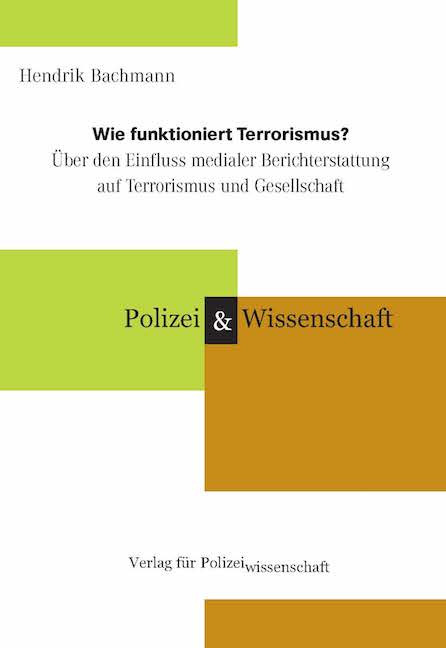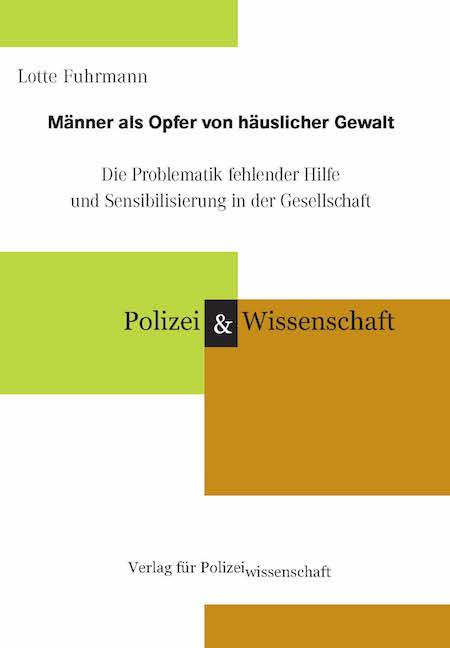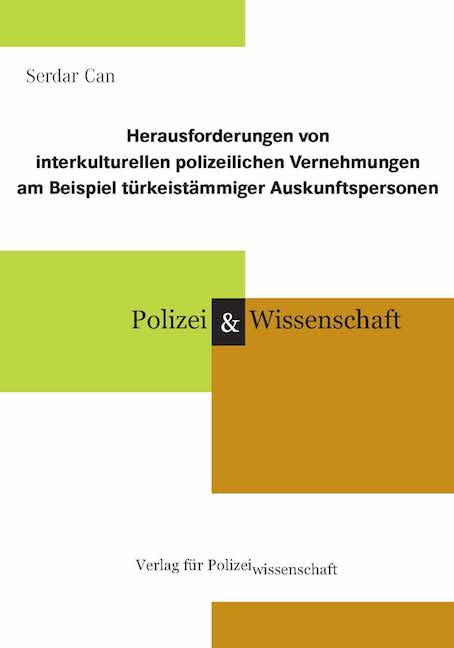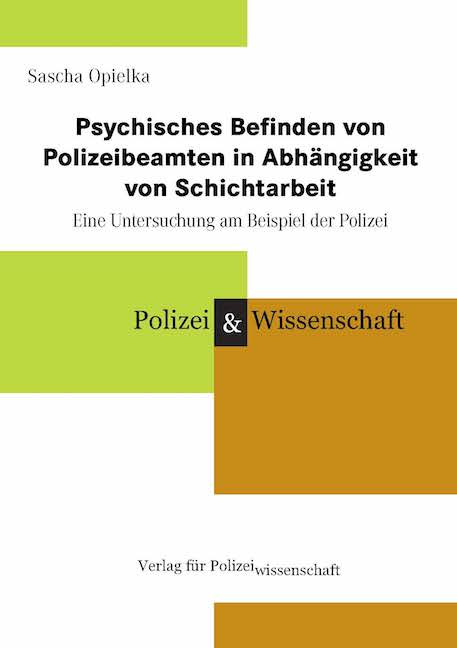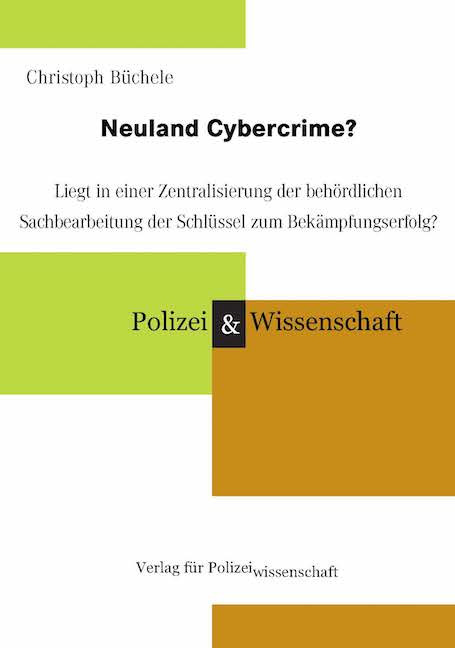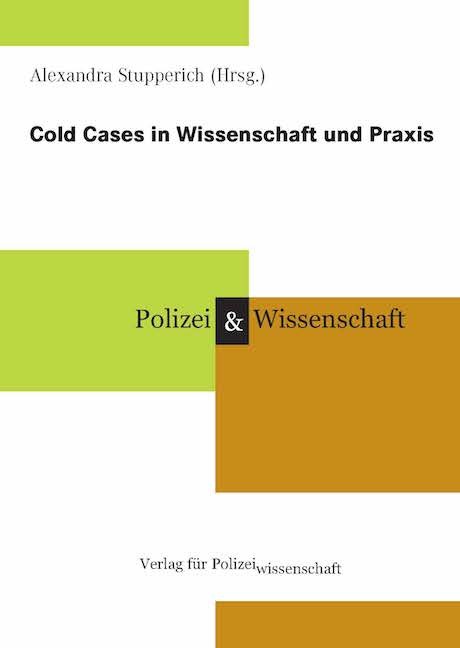Gabriela Piontkowski, Arthur Hartmann, Sarah Holland & Trygve Ben Holland
Radikalisierung und Deradikalisierung in deutschen Strafvollzugsanstalten
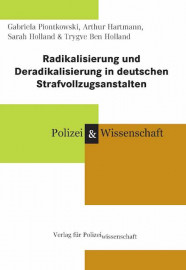
In vorliegendem Buch wird der relevante Rechtsrahmen in Deutschland vor dem Hintergrund internationaler Bestimmungen und Praktiken analysiert. Hinzu treten Befragungen von Sachverständigen aus den Bereichen Justizvollzug, Bewährungshilfe, Ministerien (politische Ebene), Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft, Verfassungsschutz, Polizei, Wissenschaft und Akteure der Zivilgesellschaft. Aus den Erkenntnissen werden Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Inhalt
Inhalt:
I Allgemeiner rechtlicher Rahmen
I-1 Ausgestaltung des Strafvollzugs
I-2 Haftarten
I-2.1 Frauenvollzug
I-2.2 Jugendstrafvollzug
I-2.3 Untersuchungshaft
I-2.4 Offener und geschlossener Vollzug
II Vollzug und Vollzugs-/Eingliederungsplanung
II-1 Planungsgrundlagen
II-2 Unterbringung
II-3 Therapie
II-4 Schulische und berufliche Qualifizierung/Ausbildung
II-5 Arbeit
II-6 Soziale Hilfen
II-7 Freizeit
II-8 Außenkontakte
II-9 Vollzugsöffnende Maßnahmen
II-10 Entlassungsvorbereitung und Nachsorge
III Erkennen von Radikalität im Strafvollzug
III-1 Untersuchungshaft
III-2 Strafhaft
III-3 VERA-2-R
III-4 RADAR-iTE
III-5 ERG 22+
III-6 MIVEA
IV Unterbringung von Gefangenen
IV-1 Offener oder geschlossener Vollzug
IV-2 Einzelunterbringung
IV-3 Wohngruppenvollzug
IV-4 Unterbringung extremistischer Gefangener
V Umgang mit extremistischen Gefangenen in JVAen
V-1 Untersuchungshaft
V-1.1 Zum Umgang mit Gefährdern
V-1.2 Zum Umgang mit Sympathisanten
V-1.3 Zum Umgang mit Gefährdeten
V-2 Strafhaft/Behandlungsvollzug
V-2.1 Therapie
V-2.2 Schulische und berufliche Qualifizierung/Ausbildung
V-2.3 Arbeit
V-2.4 Soziale Hilfen
V-2.5 Sozialtherapie als Spezialeinrichtung des Strafvollzuges
V-2.6 Freizeit
V-3 Gefangenenseelsorge
V-4 Deradikalisierungsarbeit in den Justizvollzugsanstalten
V-4.1 VPN
V-4.2 HAYAT
V-4.3 Denkzeit Gesellschaft
V-4.4 Legato KuBiBe
V-4.5 re:vision/IFAK e.V.
V-4.6 Kick-off
VI Verkehr mit der Außenwelt
VI-1 Kontaktsperre
VI-2 Besuche
VII Rechtliche Grundlagen für Sicherheitsmaßnahmen
VII-1 Besondere Sicherungsmaßnahmen
VII-2 Beschränkung des Aufenthalts in Gemeinschaft
VII-3 Disziplinarmaßnahmen
VII-4 Besonderheiten in der Untersuchungshaft
VIII Eingliederungs- und Übergangsmanagement
VIII-1 Bewährungshilfe
VIII-2 Führungsaufsicht
VIII-3 Resozialisierungsgesetze
VIII-4 Kooperationsvereinbarungen
VIII-4.1 Beispiel Hamburg
VIII-4.2 Beispiel Bremen
VIII-4.3 Beispiel Berlin
IX Grundlagen der Zusammenarbeit der Akteure/Datenschutz
IX-1 Bereichsspezifische Datenschutzregelungen
IX-2 Ausblick: Musterentwurf eines Justizvollzugsdatenschutzgesetz
IX-3 Ausblick: Entwurf Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an VO 2016/679 und zur Umsetzung RL 2016/680
IX-4 Stabsstelle NeDiS
IX-4.1 Identifizierung
IX-4.2 Prävention
IX-4.3 Deradikalisierung
IX-4.4 Koordinierung
IX-6 Kompetenzzentrum Deradikalisierung Bayern
IX-7 KODEX Bremen
X Mitarbeiter inner- und außerhalb JVAen
X-1 Ansprechpartnersystem
X-2 Strukturbeobachter
X-3 Rolle des Sicherheitsdienstleiters
X-4 Schulungen
XI Prävention
XI-1 EU Projekt PRALT
XI-2 Stärkung des Jugendgerichtswesens (EU Projekt Strengthening)
XI-3 Andere Projekte
XII Handlungsempfehlungen
Quellenverzeichnis
Gabriela Piontkowski, Arthur Hartmann, Sarah Holland & Trygve Ben Holland
Radikalisierung und Deradikalisierung in deutschen Strafvollzugsanstalten
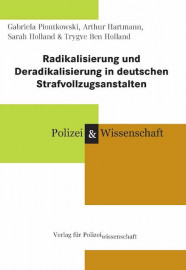
In vorliegendem Buch wird der relevante Rechtsrahmen in Deutschland vor dem Hintergrund internationaler Bestimmungen und Praktiken analysiert. Hinzu treten Befragungen von Sachverständigen aus den Bereichen Justizvollzug, Bewährungshilfe, Ministerien (politische Ebene), Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft, Verfassungsschutz, Polizei, Wissenschaft und Akteure der Zivilgesellschaft. Aus den Erkenntnissen werden Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Inhalt
Inhalt:
I Allgemeiner rechtlicher Rahmen
I-1 Ausgestaltung des Strafvollzugs
I-2 Haftarten
I-2.1 Frauenvollzug
I-2.2 Jugendstrafvollzug
I-2.3 Untersuchungshaft
I-2.4 Offener und geschlossener Vollzug
II Vollzug und Vollzugs-/Eingliederungsplanung
II-1 Planungsgrundlagen
II-2 Unterbringung
II-3 Therapie
II-4 Schulische und berufliche Qualifizierung/Ausbildung
II-5 Arbeit
II-6 Soziale Hilfen
II-7 Freizeit
II-8 Außenkontakte
II-9 Vollzugsöffnende Maßnahmen
II-10 Entlassungsvorbereitung und Nachsorge
III Erkennen von Radikalität im Strafvollzug
III-1 Untersuchungshaft
III-2 Strafhaft
III-3 VERA-2-R
III-4 RADAR-iTE
III-5 ERG 22+
III-6 MIVEA
IV Unterbringung von Gefangenen
IV-1 Offener oder geschlossener Vollzug
IV-2 Einzelunterbringung
IV-3 Wohngruppenvollzug
IV-4 Unterbringung extremistischer Gefangener
V Umgang mit extremistischen Gefangenen in JVAen
V-1 Untersuchungshaft
V-1.1 Zum Umgang mit Gefährdern
V-1.2 Zum Umgang mit Sympathisanten
V-1.3 Zum Umgang mit Gefährdeten
V-2 Strafhaft/Behandlungsvollzug
V-2.1 Therapie
V-2.2 Schulische und berufliche Qualifizierung/Ausbildung
V-2.3 Arbeit
V-2.4 Soziale Hilfen
V-2.5 Sozialtherapie als Spezialeinrichtung des Strafvollzuges
V-2.6 Freizeit
V-3 Gefangenenseelsorge
V-4 Deradikalisierungsarbeit in den Justizvollzugsanstalten
V-4.1 VPN
V-4.2 HAYAT
V-4.3 Denkzeit Gesellschaft
V-4.4 Legato KuBiBe
V-4.5 re:vision/IFAK e.V.
V-4.6 Kick-off
VI Verkehr mit der Außenwelt
VI-1 Kontaktsperre
VI-2 Besuche
VII Rechtliche Grundlagen für Sicherheitsmaßnahmen
VII-1 Besondere Sicherungsmaßnahmen
VII-2 Beschränkung des Aufenthalts in Gemeinschaft
VII-3 Disziplinarmaßnahmen
VII-4 Besonderheiten in der Untersuchungshaft
VIII Eingliederungs- und Übergangsmanagement
VIII-1 Bewährungshilfe
VIII-2 Führungsaufsicht
VIII-3 Resozialisierungsgesetze
VIII-4 Kooperationsvereinbarungen
VIII-4.1 Beispiel Hamburg
VIII-4.2 Beispiel Bremen
VIII-4.3 Beispiel Berlin
IX Grundlagen der Zusammenarbeit der Akteure/Datenschutz
IX-1 Bereichsspezifische Datenschutzregelungen
IX-2 Ausblick: Musterentwurf eines Justizvollzugsdatenschutzgesetz
IX-3 Ausblick: Entwurf Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an VO 2016/679 und zur Umsetzung RL 2016/680
IX-4 Stabsstelle NeDiS
IX-4.1 Identifizierung
IX-4.2 Prävention
IX-4.3 Deradikalisierung
IX-4.4 Koordinierung
IX-6 Kompetenzzentrum Deradikalisierung Bayern
IX-7 KODEX Bremen
X Mitarbeiter inner- und außerhalb JVAen
X-1 Ansprechpartnersystem
X-2 Strukturbeobachter
X-3 Rolle des Sicherheitsdienstleiters
X-4 Schulungen
XI Prävention
XI-1 EU Projekt PRALT
XI-2 Stärkung des Jugendgerichtswesens (EU Projekt Strengthening)
XI-3 Andere Projekte
XII Handlungsempfehlungen
Quellenverzeichnis
Hendrik Bachmann
Wie funktioniert Terrorismus? Über den Einfluss medialer Berichterstattung auf Terrorismus und Gesellschaft
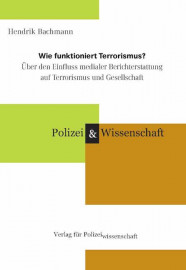
Weltweit werden seit Jahrzehnten Terroranschläge geplant und durchgeführt. Die Nachricht über einen Terroranschlag verbreitet sich innerhalb von wenigen Minuten über die ganze Welt. Terrorismus bzw. Terrorismusbekämpfung ist mittlerweile ein fester Bestandteil nicht nur deutscher Politik geworden. Die Angst vor Terrorismus ist in den westlichen Gesellschaften mittlerweile fest etabliert.
Bei der Verbreitung von Botschaften und Bildern des Terrorismus spielt die mediale Berichterstattung oft eine entscheidende Rolle. Hat diese mediale Berichterstattung einen Einfluss darauf, wie „erfolgreich“ Terrorismus ist? Wie hängen mediale Berichterstattung und Terrorismus wirklich zusammen? Wie funktioniert Terrorismus und was hat mediale Berichterstattung mit dieser Funktionalität zu tun?
Inhalt
Inhalt:
1. Vorüberlegungen
1.1 Methodik und Aufbau
1.2 Die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Angriffsziel des Terrorismus
1.3 Definitionen
1.3.1 Terrorismus
1.3.2 Medien
2. Medien und Terrorismus – eine Verbindung von Anfang an?
2.1 Mediengeschichte
2.1.1 Printmedien
2.1.2 Hörfunk und Fernsehen
2.1.3 Neue Medien (bzw. Online-Medien)
2.2 Terrorismusgeschichte
2.2.1 Die Erfindung des Terrorismus in den Jahren 1858-1866
2.2.2 Die Weiterentwicklung des Terrorismus im 19./20. Jahrhundert
2.2.3 Die neue (religiöse) Welle des Terrorismus
2.3 Zwischenergebnis
2.3.1 Auswirkungen der jüngsten Medienrevolution auf Terrorismus
2.3.2 Terrorismus in den Medien – Einflussfaktor BKA?
3. Medien als Rekrutierungshelfer für den Terrorismus?
3.1 Die fünf Schritte des Terrorismus
3.2 Empirische Studien
3.2.1 „The effect of media attention on terrorism“
3.2.2 „The Effect of US Television Coverage on Al-Qaeda Attacks“
3.3 Nachahmungstaten auf Grund medialer Berichterstattung?
3.3.1 Suizide und School Shootings
3.3.2 Contagion-Theorie
3.4 Ergebnis
4. Schlussüberlegungen
4.1 Nationaler und internationaler Diskurs
4.2 Fazit
Literaturverzeichnis
Lotte Fuhrmann
Männer als Opfer von häuslicher Gewalt Die Problematik fehlender Hilfe und Sensibilisierung in der Gesellschaft
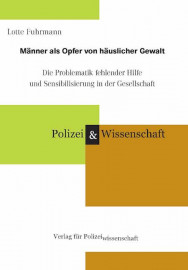
hingewiesen.
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
1.1 Fragestellung und Aufbau
1.2 Methode
2. Die historische und gesellschaftliche Einordnung häuslicher Gewalt
2.1 Der historische Kontext zur Paargewalt
2.2 Wahrnehmung der Paargewalt mit der Frauenbewegung
2.3 Die gesellschaftliche Stellung der Frau
3. Das Phänomen Paargewalt mit männlichen Opfern
3.1 Gewaltformen in Paarbeziehungen
3.1.1 Situative Paargewalt und häuslicher Terror
3.1.2 Beiderseitige Paargewalt
3.1.3 Weibliche Gewalt
3.2 Hellfelddaten – Lagebilder der Polizeien
3.2.1 Lagebild zur häuslicher Gewalt in Hessen (2017)
3.2.2 Bundeslagebild – Partnerschaftsgewalt
3.3 Erkenntnisse aus Dunkelfeldstudien
4. Der gesellschaftliche Umgang mit männlichen Opfern häuslicher Gewalt
4.1 Das Schweigen der Männer
4.2 (Fehlende) Prävention und Hilfsangebote
4.3 Der heutige Mythos: häusliche Gewalt ist Männergewalt
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Serdar Can
Herausforderungen von interkulturellen polizeilichen Vernehmungen am Beispiel türkeistämmiger Auskunftspersonen
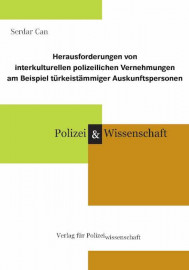
Die heraufordernde Thematik der interkulturellen polizeilichen Vernehmung hat der Autor, selbst Polizeibeamter, als Studierender im berufsbegleitenden Masterstudiengang „Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft“ an der juristischen Fakultät der Ruhruniversität Bochum im Rahmen seiner Masterarbeit (am Beispiel der Türkeistämmigen Untersuchungsgruppe) aufgegriffen und mit einer eigenen empirischen Erhebung wissenschaftlich beleuchtet. Neben der Darstellung des Phänomens einer zur Bezugsgruppe der Deutschstämmigen Auskunftspersonen vergleichsweise geringeren Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft der Türkeistämmigen werden mögliche das Phänomen begünstigende Ursachen vorgestellt. Anschließend sind in der Arbeit praktische Handlungsempfehlungen für die interkulturelle polizeiliche Vernehmungskommunikation formuliert.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
1.1 Untersuchungsgegenstand und Zielsetzung
1.2 Aufbau und Methodik der Arbeit
2 Die polizeiliche Vernehmung
2.1 Kommunikationstheoretische Aspekte
2.2 Begriffsbestimmung und Aufbau einer Vernehmung
2.3 Rechtliche Grundlagen
2.4 (Sozial)psychologische Grundlagen
2.5 Der Einfluss von Kultur
3 Die T̈ürkeistämmigen in Deutschland
3.1 Vom „Gastarbeiter“ zu Migranten
3.2 Heterogenität und sozialstrukturelle Merkmale
3.3 Herkunftskulturelle Orientierungen
3.3.1 Wertesystem und Normen
3.3.2 Ausprägung nach Hofstedes Kulturdimensionen
3.3.3 Verbale und nonverbale Kommunikation
4 Die fragile Interaktion mit dem „Fremden“
4.1 Das Verhältnis zwischen Polizei und „Fremden“
4.1.1 Kriminologisch-kriminalistische Diskurse
4.2 Bisherige Forschungen zum Untersuchungsgegenstand
4.2.1 Der interkulturelle Kommunikationskonflikt
4.2.2 Andere wissenschaftliche Arbeiten
4.3 Kursorischer Überblick über Ursachenfaktoren
5 Forschungsmethode
5.1 Vorüberlegungen
5.2 Experteninterviews als Erhebungsinstrument
5.2.1 Die befragten Experten
5.2.2 Problemzentriertes, (leitfadengestütztes) Interview
5.2.3 Transkription der Interviews
5.3 Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse
5.4 Gütekriterien
6 Darstellung der Ergebnisse
6.1 Das Phänomen der fragilen Vernehmungskommunikation
6.1.1 Die Kommunikationsmuster des Phänomens
6.2 Ursachenfaktoren und Erklärungsansätze
6.2.1 Sozialpsychologische Faktoren
6.2.1.1 Divergierender Habitus als Beziehungsblockade
6.2.1.2 Gegenseitige Vorbehalte und negative Stereotypen
6.2.2 Subkulturelle Faktoren
6.2.2.1 Polizeikultur bzw. „Cop Culture“
6.2.2.2 Die Figur des „marginal man“
6.2.3 Migrationsspezifische Faktoren
6.2.3.1 Geringere Loyalitätsbindung zur fremden Polizei
6.2.3.2 Hybride Identitätsform
6.2.3.3 Randständigkeit und Ausgrenzungserfahrungen
6.2.4 Kultur- und erziehungsspezifische Faktoren
6.2.4.1 Tradiertes Polizeibild und Erziehung im Widerspruch
6.2.4.2 Das christliche Schuld- und Vergebungsdispositiv
6.2.4.3 Gesichtswahrung und Kommunikationsstil
6.2.4.4 Polizei als Konfliktstörer
6.2.4.5 Geringere Autoritätshörigkeit gegenüber der Polizei
6.2.4.6 Kollektivkultur begünstigt Konfliktfähigkeit
6.3 Kritische Bewertung und Diskussion der Ergebnisse
6.3.1 Das Phänomen und seine Kommunikationsmuster
6.3.2 Ursachenfaktoren
6.3.2.1 Sozialpsychologische Faktoren
6.3.2.2 Kultur- und erziehungsspezifische Faktoren
6.3.2.3 Subkulturelle Faktoren
6.3.2.4 Migrationsspezifische Faktoren
6.4 Handlungsempfehlungen für Vernehmer
6.4.1 Vorbereitung
6.4.2 Kontaktphase
6.4.3 Belehrung
6.4.4 Vernehmung zur Sache
7 Fazit und Ausblick
Sascha Opielka
Psychisches Befinden von Polizeibeamten in Abhängigkeit von Schichtarbeit Eine Untersuchung am Beispiel der Polizei NRW
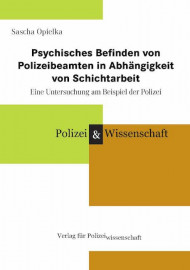
Die hier enthaltene Untersuchung setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, ob die geglaubten Zusammenhänge von Schichtarbeit und verschlechterter Psyche tatsächlich existieren und welche Rolle in diesem Zusammenhang berufsspezifische Tätigkeiten spielen. Abschließend sind erste Handlungsempfehlungen für die Ansätze des Gesundheitsmanagements der Polizeibehörden formuliert.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Normalarbeitszeit und atypische Arbeitszeit
2.2 Psychisches Befinden
2.3 Psychische Belastungen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit
2.4 Psychische Belastungen und Gesundheit im Polizeivollzugsdienst
2.4.1 Intensität und Häufigkeit belastender Ereignisse
2.4.2 Operative und organisationale Stressoren
2.5 Der Zusammenhang von Schichtarbeit und psychischem Befinden
2.6 Berufsspezifische Befunde zu Schichtarbeit und psychischem Befinden
2.7 Psychosoziale Arbeitsbelastungen in polizeilichem Tages- und Schichtdienst
2.7.1 Zeitliche Überforderung, Handlungsspielräume und soziale Unterstützung
2.7.2 Arbeitszeitautonomie
2.7.3 Die Möglichkeit, Arbeitstätigkeiten arbeitstäglich abschließen zu können
2.7.4 Emotionale Belastungen durch polizeidienstspezifische Tätigkeiten
2.8 Das Konzept des Sense of Coherence und dessen Bedeutung für den Polizeidienst
2.8.1 Historischer Überblick zum Kohärenzsinn
2.8.2 Zusammenhänge von Kohärenzsinn und Gesundheit, Stressempfinden und Arbeitszufriedenheit
2.9 Exkurs: Gesundheitsmanagement der Polizei NRW und besondere Bedingungen der Forschung im Polizeiberuf
2.10 Zusammenfassung der leitenden Fragen und Hypothesen
3 Methodenteil
3.1 Bescheibung des Vorgehens
3.2 Untersuchungsfeld und Stichprobenauswahl – Organisationsstruktur und Arbeitszeitmodelle im Polizeipräsidium Aachen
3.3 Fragebogen
3.3.1 Erfassung der psychosozialen Arbeitsbelastungen
3.3.2 Erfassung der Arbeitszeitmerkmale
3.3.3 Erfassung des psychischen Befindens
3.3.4 Erfassung soziodemographischer Variablen
3.3.5 Pretest
3.3.6 Reliabilität der Skalen
4 Ergebnisse
4.1 Deskriptive Statistik
4.2 Vergleichbarkeit von Stichprobe und Grundgesamtheit
4.3 Merkmalsunterschiede der Arbeitszeitmodelle
4.4 Zu den Fragestellungen
4.4.1 Arbeitszeit und allgemeines psychisches Befindens
4.4.2 Arbeitszeit und psychisches Befinden im Zusammenhang mit der Arbeit
4.4.3 Arbeitszeit und Kohärenzerleben
4.4.4 Arbeitszeit und psychosoziale Arbeitsbelastungen
4.4.5 Effekte psychosozialer Arbeitsbelastungen auf psychisches Befinden
5 Diskussion
5.1 Bewertung der Ergebnisse der Untersuchung
5.1.1 Zusammenhang von Arbeitszeitmodell und psychischem Befinden
5.1.2 Zusammenhang von Arbeitszeitmodell und psychosozialen Arbeitsbelastungen
5.1.4 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse zu den leitenden Fragestellungen
5.2 Limitationen
5.3 Praktische Empfehlungen
5.4 Allgemeine Schlussfolgerungen
6 Literatur
7 Anlagen
Christoph Büchele
Neuland Cybercrime? Liegt in einer Zentralisierung der behördlichen Sachbearbeitung der Schlüssel zum Bekämpfungserfolg?
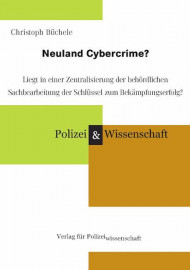
Diese Arbeit kann deshalb auch als grundsätzliches Nachschlagewerk zur Thematik dienen.
Die zugrundeliegende Master Thesis wurde 2016 im Studium „Kriminalistik“ an der Steinbeis-Hochschule Berlin erstellt und im Oktober 2017 mit dem Preis der deutschen Gesellschaft für Kriminalistik (DGfK) ausgezeichnet.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
1 Einleitung: Herausforderungen einer neuen Kriminalitätsform
2 Begriff Cybercrime
2.1 Cybercrime und seine Synonyme
2.2 Definitionen des BKA
2.3 Definition der EU-Kommission
2.4 Fazit: Definition Cybercrime muss „Cyber“ und „Crime“ beinhalten
3 Ursachen und Katalysatoren von Cybercrime
3.1 Hinführung
3.2 Globalisierung
3.3 Digitalisierung
3.4 Fazit: „Neuland“ für Strafverfolger – „Kiez“ für Straftäter
4 Lagebild
4.1 Behördliche Lagebilder
4.2 Forschung
5 Erscheinungsformen von Cybercrime
5.1 Hinführung
5.2 Unkompliziertes Anbieten, Veröffentlichen und Verbreiten von Daten und Inhalten
5.3 Diebstahl von Informationen
5.4 Angriffe auf Daten und EDV-Systeme
5.5 Schadsoftware
5.6 Täuschung und Betrug
5.7 Fazit: Vielfältige Handlungsoptionen für unterschiedliche Straftäter
6 Zuständigkeit für die Sachbearbeitung
6.1 Hinführung
6.2 Entscheidungsgrundlage: Tatort
6.3 Regelungslage Polizei
6.4 Regelungslage Staatsanwaltschaft
6.5 Organisatorisches Herangehen
6.6 Fazit: Traditionelle Kriterien für die Bestimmung der Zuständigkeit sind im Bereich Cybercrime kritisch zu sehen
7 Erläuterung der wissenschaftlichen Methoden
7.1 Übersicht über die Methoden
7.2 Experteninterview
8 Betrügerische Angebote auf Online-Immobilienbörsen
8.1 Phänomenbeschreibung
8.2 Vorbemerkung
8.3 Fallauswertungen
8.4 Interviews
8.5 Fazit: Betrügerische Immobilienangebote – ein verwaltetes Phänomen
9 Windows-Verschlüsselungs-Trojaner
9.1 Phänomenbeschreibung
9.2 Interviews
9.3 Fazit: WVT-Verfahren – ein vielversprechendes Ermittlungsvorgehen
10 Zentrale Prüfung der These
10.1 Positive Effekte der zentralisierten Bearbeitung
10.2 Nachteile
10.3 Rahmenbedingungen
10.4 Validität der Ergebnisse
11 Fazit: Zentralisierte Verfahren – die Antwort auf die Herausforderung
12 Literaturverzeichnis
13 Anhang
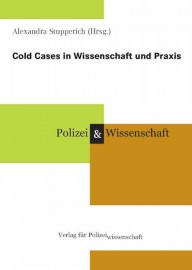
Im ersten Teil dieses Buchs soll definiert werden, was Cold Cases überhaupt sind und ein Überblick zu den besonderen kriminalistischen Herausforderungen gegeben werden. Ein Beitrag von Dr. Bernd Körber, beschäftigt sich zudem mit den Besonderheiten der Vernehmung von Zeugen in Cold Case Ermittlungen. Im zweiten Teil stellt Steven Baack vom LKA Hamburg seine Erfahrungen aus der praktischen Ermittlungsarbeit an Cold Cases dar. Am Ende des Buches wird von Dr Alexandra Stupperich eine Methode des Cold Case Review Prozesse vorgestellt. Dr. Helga Ihm schildert dazu in ihrem Beitrag zur Psychologischen Autopsie ein Verfahren zur post mortem Beurteilung der prämortalen Bedingungen, welche zu dem tödlichen Ereignis führten.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
1 Einleitung
2 Cold Cases – Ein neuer Begriff für ein altes Phänomen?
2.1 Definition des Begriffs Cold Cases
2.2 Entwicklungen im In- und Ausland
Exkurs: Cold Cases – Management in Hamburg (Steven Baack)
3 Besonderheiten von Cold Cases
3.1 Aufklärungsimmanente Kriterien von Tötungsdelikten
3.2 Fallspezifischer Faktor
3.2.1 Delikttyp
3.3.2 Besondere Tatbestandsmerkmale
Exkurs: Investigative Psychologie: Gedächtnisbasierte Methoden zur Zeugenvernehmung in Cold Case Fällen (Bernd Körber)
3.3 Räumlicher und geografischer Faktor
3.3.1 Urbane und ländliche Regionen
3.3.2 Lokalisation von Tatort und Fundort
3.4 Opferfaktoren
Exkurs: Psychologische Autopsie (Helga Ihm)
3.5 Organisatorischer Faktor
4 Cold Case Reviews: Das Nienburger-Modell
4.1 Wahlpflichtfach ‚Cold Cases‘ – ein hochschuldidaktischer Überblick
4.1.1 Sachkompetenz
4.1.2 Selbstkompetenz
4.1.3 Soziale Kompetenz
4.1.4 Das Konzept des Lernens in Gruppen
4.2 Struktur des Nienburger Modells
4.2.1 Tötungsdelikte
4.2.2 Vermisstenfälle
4.2.3 Erfahrungen mit dem Nienburger Modell
4.3.4 Evaluation
4.4 Fazit
5 Abschlussbetrachtung